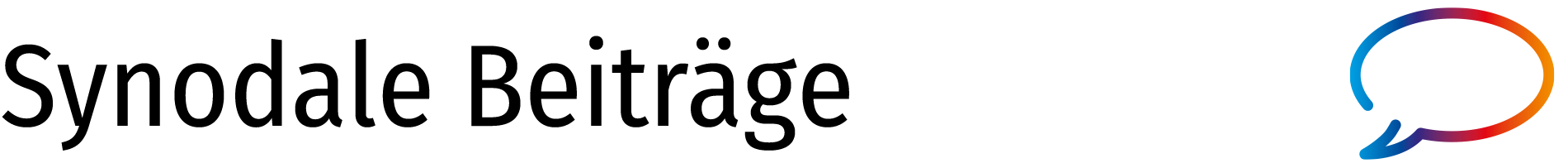06. September 2022 | Der synodale Irrweg
Autor: Von Dr. Martin Grichting
Quelle: Neue Zürcher Zeitung
Mittels eines «synodalen Wegs» soll in Deutschland die katholische Kirche durch substanzielle Anpassungen der Glaubenslehre im postchristlichen Mainstream gehalten werden. Zahlreiche Bischöfe und Laienfunktionäre, die diesen «Reformprozess» vorantreiben, werden sich innerhalb der von ihnen geschaffenen Beschlussstrukturen zwar durchzusetzen vermögen. Aber dies ist ein Pyrrhussieg, weil sich die gewonnene Definitionsmacht über den Glauben nicht in ein ökonomisch funktionierendes Kirchentum umsetzen lässt.
Ein formelles Schisma, eine Kirchenspaltung, kann sich die Mehrheit des «synodalen Wegs» nicht leisten. Denn der deutsche Staat hat Konkordate und andere völkerrechtlich bindende Verträge mit dem Heiligen Stuhl zugunsten der katholischen Kirche abgeschlossen. Und ob der Staat einer neuen deutschen Nationalkirche den Status einer öffentlichrechtlichen Körperschaft verleihen sowie diese finanziell privilegieren würde, ist ungewiss.
Auf Gedeih und Verderb
Die Minderheit der Teilnehmer des «synodalen Wegs», die am herkömmlichen Glauben der Kirche festhält, ist in den bisherigen Synodalversammlungen überstimmt worden. Dies ist jedoch nur eine vermeintliche Niederlage. Denn diese Minderheit ist verbunden mit der Weltkirche und würde im Fall einer Spaltung den Namen «katholisch» behalten, was rechtlich und ökonomisch die bessere Ausgangslage bedeutet. Demonstrativ hat ihr der Vatikan im vergangenen Juli denn auch den Rücken gestärkt.
Das Ergebnis des «synodalen Wegs» – in Analogie auch des Schweizer Imitats – wird deshalb eine Pattsituation sein. Auch wenn sich die Geschichte nicht wiederholt: Es gibt eine kirchengeschichtliche Parallele, die von Bedeutung ist. Die evangelisch-reformierten Landeskirchen der Schweiz entzweiten sich inhaltlich Mitte des 19. Jahrhunderts in ein orthodoxes und ein freisinniges Glaubensbekenntnis. Sie konnten sich jedoch nicht trennen, weil sie dadurch des Status der Staatskirche und der damit verbundenen Finanzierung verlustig gegangen wären. So mussten sie auf Gedeih und Verderb zusammenbleiben.
Das Beispiel Zürich
Die Differenzen waren fundamental, wie sich am Beispiel Zürichs, des zwinglianischen Stammlands, zeigte. Ehrlichkeit war schon damals ein knappes Gut. Denn man sprach betreffend die «Freisinnigen» lange nur von einer «Richtung» und von «reformerischen Anschauungen».
Im Jahr 1865 klärten sich jedoch die Dinge, denn der Pfarrer einer Zürcher Landgemeinde, Salomon Vögelin aus Uster, legte die Karten auf den Tisch. Jesus Christus sei nur ein Mensch gewesen, hielt er fest in der Einleitung zum Band, in dem er seine Predigten herausgab. Gleichwohl lasse man den gemeinen Mann von der Kanzel aus glauben, an Weihnachten sei auf übernatürliche Weise ein Wesen höherer Art zur Welt gekommen, am Karfreitag sei die Welt mit Gott versöhnt, an Ostern der gestorbene Jesus wiederbelebt worden und an Auffahrt sei dieser leiblich in den Himmel aufgefahren.
Das Antibekenntnis gipfelte im Satz: «Es wird da, wo eine neue religiöse Weltanschauung im Gegensatz gegen die alte waltet, immer so gesprochen, als handelte es sich nur darum, diese alte Lehre in neuer Form zu verkünden und neu zu begründen; dieser Zustand ist eine Unwahrheit.»
Die Kirchenleitung war sich bewusst, dass dieses Nichtbekenntnis die Landeskirche spalten musste. Ihre «Synode», die Pfarrerversammlung, lehnte es jedoch 1865 ab, Sanktionen gegen Vögelin zu fordern. Mit dieser faktischen Anerkennung der Bekenntnisfreiheit – der Freiheit von einem verbindlichen Glaubensbekenntnis – gab sich die «reformerische» Richtung jedoch nicht zufrieden. Sie verlangte und erhielt die formelle kirchliche Anerkennung ihres postchristlichen Deismus oder Agnostizismus bereits im Jahr 1868. Denn die Zürcher Landeskirche erliess eine Tauf- und Abendmahlsliturgie jeweils in doppelter Ausführung: Eine Fassung behielt das Apostolische Glaubensbekenntnis bei, das vom Gottessohn Jesus Christus spricht, die andere nicht.
Aufsplitterung in mehrere Gesinnungsgemeinden
Seit 1868 ist nicht mehr das Glaubensbekenntnis das einende Element dieser und der übrigen reformierten Landeskirchen, sondern der Staat. Die Landeskirche werde «gleichsam zu einem äusseren Rahmen, der sehr Divergierendes und Widersprechendes notdürftig zusammenhält», wie der Zürcher Antistes (Oberpfarrer) Georg Finsler seinerzeit resümierte. Das sei der Auflösung der Kirche und ihrer Spaltung in zwei Kirchen vorzuziehen. Denn so bleibe sie eine «äussere Anstalt, die ihre bestimmte Stelle im staatlichen Organismus hat». Zu dieser «äusseren Anstalt» gehören heute, politisch konnotiert, eine liberale, eine evangelisch-kirchliche und eine religiös-soziale – sozialistische – Fraktion sowie ein «Synodalverein». Bei der «Trennung von Kirche und Staat», wenn sich Letzterer als Gesetzgeber der Landeskirche zurückzöge, würde sich die «äussere Anstalt» in mehrere Gesinnungsgemeinden aufsplittern. So bekannte es die Zürcher Landeskirche im Jahre 1995 selbst.
Karl Barth hat für dieses Konstrukt den Begriff der «Bekenntnisschwäche» geprägt. Denn Bekennen und Nichtbekennen seien gleichermassen erlaubt. Das bedeute nicht, dass auf religiösem Gebiet alles gleich sei und die «gegnerische Anschauung» die gleiche Berechtigung besitze wie die eigene, meinte im Jahr 1881 Antistes Finsler. Denn dies wäre ein «sittliches Unding». Vielmehr räume man der «Gegenpartei» das Recht ein, «in der Kirche zu existieren, wobei ein ehrlicher Kampf nicht fehlen soll und kann».
Ergebnis des innerkirchlichen Parteienwesens ist ein kontinuierliches Ausbluten der reformierten Zürcher Landeskirche. 1860 umfasste sie noch 95,7 Prozent der Bevölkerung. Ende 2021 waren es noch 25,4 Prozent, wobei die Talsohle nicht in Sicht ist. Reformierte Pfarrherren kokettieren mittlerweile damit, dass sie das Totenglöckchen der Landeskirche läuten hörten. Diese Entwicklung überrascht nicht. Denn die Anhänger dieser «Glaubensgemeinschaft» können nicht mehr unzweideutig verkünden, weil sie stets Rücksicht auf die anderslautenden Lehren der innerkirchlichen Gegenparteien nehmen müssen. Profillosigkeit und das Ausweichen auf die Felder der Moral sowie der Tagespolitik sind die Folge.
Das Beispiel der reformierten Schweizer Landeskirchen gilt es zu bedenken, wenn man in der katholischen Kirche in Deutschland und in der Schweiz aus ökonomischen Gründen ein Zusammenleben von verschiedenen «Richtungen» unter einem vom Staat aufrechterhaltenen Dach anzielen sollte. Denn dieses Exempel zeigt zwar, dass Mammon mächtig ist. Aber er vermag die weitere innere Spaltung und das Ausbluten der Kirche nicht zu verhindern.
Es drohen bleierne Jahre
Karl Barth hat im Jahr 1935 bemerkt, er habe in Deutschland erkannt, wie brennend die «Bekenntnisfrage» wieder werden könne. In der Schweiz werde die Bekenntnisfrage jedoch erst brennend werden, wenn es zu einer «Anfechtung der ganzen Kirche, einer Überwindung ihrer geistlichen Not durch ein grosses, von aussen über sie hereinbrechendes Gericht» komme. Es habe keinen Sinn, darüber zu spekulieren, wann der bekenntnisschwache Status quo durch Tatsachen überholt sein werde. Man solle als Pfarrer jedoch einstweilen sich selbst und die Gemeinden wieder «gewöhnen an den Gedanken des Bekenntnisses».
Ob und wann der Staat sein Interesse an den von ihm alimentierten Kirchentümern verlieren wird, ist auch heute schwer abzuschätzen. Absehbar ist hingegen, dass ein ökonomisch motiviertes Zusammenleben unvereinbarer Glaubenshaltungen unter einem Dach den evangelisierenden Eifer weiter lähmen wird. Kommt es im Gefolge des «synodalen Wegs» dies- und jenseits des Rheins zu solch einem «Unding», drohen bleierne Jahre. Wer am ganzen Evangelium und an der Lehre der Kirche festhält, kann dann nur noch mit Léon Bloy sagen: «Ich warte auf die Kosaken und den Heiligen Geist.»
Martin Grichting war Generalvikar des Bistums Chur und beschäftigt sich publizistisch mit philosophischen sowie religiösen Fragen.