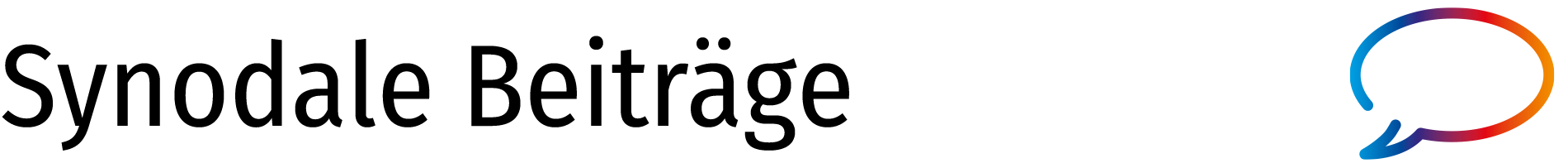02. September 2022 | Realpräsenz, Sakramentalität und der Synodale Weg in Deutschland
Autor: Bischof Dr. Stefan Oster
Quelle: Internationale katholische Zeitschrift COMMUNIO Ausgabe 4/2022 www.communio.de
Erfahrungen des Anfangs: Eine Synode in Rom
Im Oktober 2018 hatte ich die Gelegenheit, an der Weltbischofssynode in Rom teilzunehmen, die sich unter dem Titel: «Die Jugendlichen, der Glaube und die Erkenntnis der Berufung» versammelt hatte. Zahlreiche Bischöfe und Ordensobere aus der ganzen Welt, Beraterinnen und Berater – und vor allem auch junge Menschen haben einen Monat lang darüber beraten, wie es heute möglich ist, mit jungen Menschen zusammen Kirche zu sein und zu leben – und ihnen Wegbegleiter zu sein auf dem Weg ins Leben, in den Glauben und in das Finden ihrer Berufung. Papst Franziskus war in den meisten Plenarversammlungen anwesend und hat mehrfach erläutert, wie er Synodalität versteht.
Wichtig war ihm in den Plenarsitzungen, dass nach jeweils fünf vierminütigen Redebeiträgen ein dreiminütiges Schweigen eingelegt wird. Wir sollten mit ihm lernen, Hörende zu werden. Zuhören, so der Papst sei nicht nur eine natürliche Fähigkeit, Zuhören sei auch ein theologischer Begriff, denn Gott hört nach der Schrift die Klage seines Volkes (vgl. Ex 3,7). Wichtig war dem Papst auch folgendes: Die Synodalversammlung sei ein geschützter Raum. Als Medienvertreter waren daher nur die eigenen von Radio Vatikan anwesend, alle anderen Berichterstatter aus der ganzen Welt sind jeweils nach den unterschiedlichen Etappen der Versammlungen in Pressekonferenzen informiert worden. Die Eröffnung eines geschützten Raums war für den Papst deshalb wichtig, weil jeder die Gelegenheit bekommen sollte, aus freiem Herzen zu sagen, was ihm wichtig ist. Und zwar nach Möglichkeit ohne das Schielen auf Zustimmung oder auf Mehrheiten oder auf Medien, ohne politisches Kalkül, ohne Taktik. Warum? Weil nach der Auffassung des Papstes nur dann der Hl. Geist wirken und leiten kann. Er kann auf diese Weise so wirken, dass eine hörende Gemeinschaft entsteht, in der einer den anderen in Wohlwollen wahrnimmt, eine Gemeinschaft, die sich einüben kann in der Unterscheidung; die sich in Richtung Einmütigkeit bewegen kann, weil sie sich vom Geist führen lässt, der Liebe ist und zur Einheit drängt. Eine Synode, so der Papst immer wieder und überdeutlich, ist kein Parlament. Synodalität bedeutet gerade nicht: Politik!
Zudem hat der Papst immer wieder auch betont, dass er selbst in seinem Amt einheitsstiftendes Prinzip ist: sub Petro und cum Petro. Am Ende liegt die Verantwortung für Entscheidungen bei ihm selbst (decision taking) im Unterschied zum Diskussions- und Findungsprozess (decision making). Abstimmen über Textabschnitte des Abschlussdokumentes konnten zuletzt nur die ordentlichen Synodenteilnehmer, also vor allem die Bischöfe, die Hirten – und zum Beispiel nicht die Beraterinnen und Berater. Papst Franziskus macht damit deutlich, dass die Kirche Weggemeinschaft aller ist. Alle sind zur Mitsprache und zum Mitwirken eingeladen, aber zugleich ist diese Kirche hierarchisch, episkopal verfasst, weshalb wesentliche Entscheidungen dann von den Bischöfen oder eben dem Bischof von Rom zu treffen sind. Auch der Wegcharakter sollte schließlich deutlich werden, so sehr, dass sich die meisten Synodenteilnehmer auf eine gemeinsame halbtägige Fußwallfahrt begeben haben und dazu auch noch zusätzlich viele Jugendliche von außen eingeladen waren, aus Rom und Umgebung. Gemeinsam auf dem Weg – mit jungen Menschen und für sie, offen für das Wirken des Geistes, der immer wieder überrascht und Kirche jung sein lässt. Alle sind eingeladen mitzugehen in dieser Kirche, die mit Jesus geht, die miteinander betet, die zuhört und auf sein Wort hört – und in der Menschen ein solidarisches Miteinander leben.
Zurück in Deutschland: Die MHG-Studie als Auslöser
Dies sind mit einigen knappen Strichen gezeichnet die Erfahrungen gewesen, mit denen ich zurück in Deutschland mit der Idee eines synodalen Weges konfrontiert worden bin. Auslöser war die MHG-Studie, in der der Missbrauch von Klerikern an Minderjährigen in Deutschland in den letzten Jahrzehnten untersucht worden ist. Die Ergebnisse zeigten ein erschreckendes Ausmaß an Missbrauchstaten, -tätern und -betroffenen – und damit eine dramatische Perversion des Evangeliums vom Heil mitten im Herzen der Kirche. Für viele Menschen ist sie dadurch Ort des Unheils geworden. Die Autoren der MHG-Studie, die bei der Herbstvollversammlung in Fulda 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, empfehlen die Überprüfung der kirchlichen Machtstrukturen, der kirchlichen Sexualmoral und der priesterlichen Lebensform. Bei der darauf folgenden Vollversammlung der Bischofskonferenz in Lingen im Frühjahr 2019 haben zahlreiche Bischöfe geäußert, dass es erheblichen Druck aus dem Gottesvolk gebe, ebenso wie aus der medialen und politischen Öffentlichkeit. Es müsse endlich etwas geschehen – und ermutigt von Papst Franziskus‘ Einladungen zum offenen Gespräch wolle man sich auf einen «verbindlichen, synodalen Weg» machen. In einer ersten Abstimmung sagten nahezu alle Bischöfe zu, dabei zu sein, bei wenigen Enthaltungen. Ich habe auch zugesagt, weil ich tatsächlich glaube, dass Dialog, Austausch gerade über wesentliche Themen und gegenseitiges Hören zum Wesentlichen in der Kirche gehören – ohne freilich genauere Vorstellungen zu haben, welche Dimension ein solches «Gesprächsformat» haben würde. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) sollte als Partner und Mitveranstalter eingeladen werden. Drei Themenforen zu Macht, kirchlicher Sexualmoral und priesterlicher Lebensform sollten den Weg vorbereiten – und erste Texte erstellen. Es zeigte sich schnell, dass das Zentralkomitee bereit war, diesen Weg verantwortlich mitzugestalten, aber nur unter der Bedingung, dass auch über die Frauenfrage gesprochen werden sollte, konkret über «Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche». Da in der den Synodalen Weg auslösenden MHG-Studie dieses Thema nicht verhandelt worden war, stellte sich einigen Beobachtern schnell die Frage, ob nicht der ganze Synodale Weg nun für eine bestimmte kirchenpolitische Reformagenda genutzt werden sollte. Die Deutsche Bischofskonferenz ließ sich aber mehrheitlich auf die Bedingung des ZdK ein und nahm dieses Thema mit großer Mehrheit zu den anderen drei Themen als ein viertes hinzu.
Weitere Themenvorschläge von einzelnen Bischöfen, die sich auf einen mahnenden Brief des Papstes an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland (vom 29. Juni 2019) bezogen und Themen wie neue Evangelisierung, Katechese, Berufungspastoral und andere einbringen wollten, bekamen in der Bischofskonferenz keine Mehrheit. Ebenso scheiterte dort ein Versuch, die Enzyklika «Laudato si» zum Thema von Reforminitiativen mit Anschlussmöglichkeiten an gesellschaftliche Diskurse zu machen. So blieben die vorgeschlagenen und dann auch vorgegebenen Reformthemen auf die Vorschläge der MHG-Studie bezogen, die Frauenfrage dazu genommen, und haben damit zunächst ausschließlich innerkirchliche Relevanz. Es gehe um die systemischen Faktoren, die Missbrauch begünstigen würden, hieß es. Wenn dann nachgefragt wurde, wie sich das denn mit der Aufforderung des Papstes in seinem Brief vertrage, an erster Stelle die Evangelisierung voranzubringen, waren die am häufigsten zu hörenden Antworten: Diese oft so genannten Reizthemen seien diejenigen, die die Evangelisierung am meisten behinderten. Daher sei deren Reform an sich schon ein echtes Evangelisierungsprogramm. Denn dann – wenn diese abgeräumt seien – müsse man sich für seine Kirche in einer modernen Gesellschaft endlich nicht mehr schämen. Zudem würden gerade diese Themen zeigen, dass das «System Kirche» Veränderung brauche – wenn nötig auch regionale Veränderungen, die ja nicht gleich die ganze Weltkirche zu betreffen bräuchten.
Und weil klar war, dass der größere Teil der entscheidenden oder zu erwartenden Beschlüsse in die Zuständigkeit des universalen Lehramtes gehören würden, wurde eben – unter Berufung auf die Ermutigung durch Papst Franziskus – der Synodale Weg erfunden – ein Gremium, das sehr bewusst keine nationale Synode sein will (oder im öffentlichen Diskurs dann doch wieder sein wollte, zumindest mit ähnlichem Gewicht!). Zumindest wollte man keine Synode in dem Sinn veranstalten, den das Kirchenrecht vorgibt, denn dann hätte man formal und inhaltlich den apostolischen Stuhl mit einbinden und in nicht wenigen Punkten um Genehmigung ersuchen müssen. Stattdessen wurde also unter dem Druck der Ereignisse in Deutschland und nach dem unbefriedigenden Ausgang früherer Gesprächsprozesse ein «verbindlicher Synodaler Weg» beschlossen, bei dem die früher aber mangels nationaler Zuständigkeit eher ausgesparten Reizthemen nun explizit einbeschlossen waren – und im Grunde nur diese; zumal drei von vier davon in der MHG-Studie als mögliche Ursachen für systemische Begünstigung von sexuellem Missbrauch genannt wurden. Wie genau die «Verbindlichkeit» des Synodalen Weges sich am Ende darstellen wird, ist bis dato nicht klar, weil zugleich in der beschlossenen Satzung (Artikel 11.5) des Weges auch betont wurde: «Beschlüsse der Synodalversammlung entfalten von sich aus keine Rechtswirkung. Die Vollmacht der Bischofskonferenz und der einzelnen Diözesanbischöfe, im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit Rechtsnormen zu erlassen und ihr Lehramt auszuüben, bleibt durch die Beschlüsse unberührt.»
Bevor der eigentliche Weg begann, formierten sich vier vorbereitende Foren mit ersten Textentwürfen. Die Vorsitzenden der Foren waren jeweils ein Vertreter der Bischofskonferenz und ein Mitglied des ZdK – wie auch später bei den dann von der ersten Synodalversammlung im Dezember 2019 eingesetzten Synodalforen. Die Mitglieder der Foren und der Synodalversammlung sind nicht identisch. Expertinnen und Experten wurden jeweils hinzugezogen, wobei die Auswahlkriterien und das Auswahlverfahren nicht durchgehend transparent waren. Dass in allen vier Foren diejenigen, die deutliche inhaltliche Veränderungen in Lehre, Praxis und Leitungsformen der Kirche wünschen, die klare Mehrheit stellten, zeigte sich früh und war ohne Frage von den eigentlichen Konstrukteuren des Synodalen Weges auch so gewollt. Die Frage ist: Entspricht diese Mehrheitsbildung in geschätzt 80 Prozent der jeweiligen Gremien auch den tatsächlichen Mehrheitsverhältnissen etwa bei solchen Katholiken in Deutschland, die einigermaßen regelmäßig am kirchlichen Leben teilnehmen? Selbstverständlich wurden auch einige repräsentative Männer und Frauen hinzugenommen, die sich zwar ebenso eine Kirchenerneuerung und Umkehr in Deutschland wünschen, allerdings grundsätzlich eher auf der Basis der geltenden Lehre und des geltenden kirchlichen Rechts auch im Blick auf die hierarchische Struktur – ohne freilich dabei deren Entwicklungsmöglichkeiten zu verneinen. Die Frage der Repräsentation ist jedenfalls eine schwerwiegende, da es eine zahlenmäßig nicht leicht einzuschätzende konservative Minderheit innerhalb des Katholizismus in Deutschland gibt, die sich regelmäßig und lautstark vom Zentralkomitee distanziert – und dessen Vertretungsanspruch für sie als Laien in der Kirche in Deutschland verneint.
Die Synodalversammlung besteht zunächst aus 69 (d.h. allen) Mitgliedern der deutschen Bischofskonferenz und ebenso vielen Mitgliedern des ZdK. Daneben wurden aus kirchlichen Berufsgruppen, Jugendlichen (ausgewählt vom BDKJ), Orden, neuen geistlichen Gemeinschaften und anderen nach unterschiedlichen Verfahren weitere Mitglieder berufen. Insgesamt sind es rund 230 Mitglieder, daneben Beraterinnen und Berater und Beobachterinnen und Beobachter aus anderen Ländern und Konfessionen. Von Anfang an war sehr deutlich, dass die Zahl derer, die massive inhaltliche und strukturelle Reformen wünschen, auch in der Synodalversammlung in einer überdeutlichen Mehrheit ist. In den Augen der Beobachter kam es daher vor allem darauf an, wie die Bischöfe abstimmen würden und wie in deren Reihen das Verhältnis von «Reformern» und «Bewahrern» sein würde. Dass dies wenigstens anfänglich nicht allzu leicht kalkulierbar war, liegt an der hohen Zahl der Weihbischöfe, deren öffentliche Äußerungen zu den Themen des Synodalen Weges grundsätzlich viel zurückhaltender sind als die der Diözesanbischöfe. Beschlüsse des Synodalen Weges brauchen jedenfalls die Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder der Synodalversammlung und zusätzlich von zwei Dritteln der Bischöfe, um Geltung zu erlangen. Wobei noch einmal die Frage ist: Geltung wo und für wen?
Der geschützte Raum und der Heilige Geist
Der einleitend von Papst Franziskus betonte und als nötig erachtete «geschützte Raum» war und ist in der Synodalversammlung zu keiner Zeit gegeben und damit war und ist es auch zu keiner Zeit eine Versammlung, die jenseits von kirchenpolitischen Agenden, Allianzen und Zielen ausschließlich an der Sache entlang diskutiert. Dabei ist die Frage zu stellen, ob es eine solche geschützte synodale Debatte jemals in Reinform auch tatsächlich gegeben hat – oder ob das nicht erst ein durch die Ära Franziskus entstandenes und von ihm selbst erklärtes Ideal ist, dessen Umsetzung erst noch zu finden wäre. Dass der «geschützte Raum» beim Synodalen Weg nicht gegeben war und ist, liegt aber auch an der zumindest nichtöffentlich immer wieder erklärten Absicht mancher Protagonisten, die möglichen «Bremser» durch möglichst hohe öffentliche Beteiligung auch möglichst großem öffentlichem Druck aussetzen zu können. Zu klar waren ja die seit Jahrzehnten auch unabhängig von der MHG-Studie vor allem vom ZdK artikulierten Reformforderungen und Erwartungen von Anfang an. Und sie wurden und werden auch von den Hauptakteuren im Präsidium fortlaufend formuliert – und in öffentlichen Äußerungen immer wieder als notwendige Änderungen schon vor ihrer Beschlussfassung angekündigt. Wenn ich aber den Papst richtig verstanden habe, stehen in einer synodalen Versammlung nach seinen Vorstellungen die Ergebnisse im Vorfeld gerade nicht fest, andernfalls könne der Geist nicht wirken; zumal Franziskus den Geist immer wieder als den Geist der Überraschungen beschreibt. Und tatsächlich: Überraschend wäre an den zu erwartenden Ergebnissen bei der derzeitigen Zusammensetzung des Synodalen Weges im Grunde fast gar nichts mehr. Außer vielleicht die womöglich doch überraschend große Mehrheit für die angestrebten Veränderungen auf der Seite der Bischöfe.
In den großen Texten des Thomas von Aquin gibt es ein ihn leitendes Prinzip: Er versucht die Argumente seiner theologischen Gesprächspartner und Gegner gut zu verstehen und selbst noch einmal in Zuspitzung präzise zu formulieren, um diese Argumente ausdrücklich zu würdigen und um den theologischen Gesprächspartner tatsächlich stark zu machen – und um selbst das, was daran wahr ist, tiefer zu verstehen und wenn nötig auch mit noch besseren Argumenten zu widerlegen. Einen solchen Respekt vor der auch in den heiklen Fragen immer noch geltenden Tradition der Kirche habe ich immerhin in den Sitzungen meines Forums ein wenig und bei Einzelnen erlebt. Aber die weite Mehrheit war auch hier eher ungeduldig: Allzu schnell sollten traditionelle Positionen dekonstruiert bis unmöglich gemacht werden; bzw. war vielen von vorneherein klar, dass sie ohnehin bereits unmöglich sind. Gegenseitiger Respekt vor dem jeweiligen Gesprächspartner und der aufrichtige Wunsch zu hören, waren in meinem Forum aber schon zu spüren und wie ich höre, in anderen auch. Ich bin Mitglied im Synodalforum IV, in dem es um die Sexualmoral geht. In der Synodalversammlung war die Stimmung dagegen herausfordernder. Immer wieder hat das Präsidium im Anliegen, die Stimmung nicht allzu emotional gegen die vermuteten Konservativen werden zu lassen, mit Regularien oder Ermahnungen eingegriffen oder nach Protesten eingreifen müssen. Zumal die Öffentlichkeit von Anfang an und sehr bewusst im vollen Umfang die Sitzung live verfolgen konnte. «Geschützt» im Sinn des Papstes fühlte sich hier aus der Minderheitenposition vermutlich niemand. Und wenn diese Ungeschütztheit bemängelt wurde, wurde auf die Foren verwiesen. Dort sei geschützter Raum und dort passiere dann ja auch die eigentliche Arbeit an den Themen und Texten. Tatsächlich aber haben die Foren nur vorbereiten-den Charakter, weshalb man dann am Ende doch gespannt auf Debatten und Abstimmungen bei den Synodalversammlungen schaut. Trotz dieser für einige einschüchternden äußeren Bedingungen – nicht selten erzählten Vertreterinnen und Vertreter der Minderheitspositionen von massivem emotionalem Stress – wurde von Präsidiumsmitgliedern und vielen anderen immer wieder euphorisch von einem «Geist von Frankfurt» gesprochen, selbstverständlich nicht ohne damit auch den Geist Gottes wenigstens auch mit zu meinen. Dieser aber hat – so wie ich Papst Franziskus verstehe – mit Politik eher wenig zu tun.
Papst Franziskus als Ermutiger und Anreger für synodale Prozesse ist dann übrigens nach eigenem Bekunden auch nicht dafür, dass grundlegende Glaubensinhalte durch synodale Prozesse zur Disposition stehen. So sagt er wörtlich: «Beim Sprechen über Synodalität ist es wichtig, Lehre und Tradition nicht mit den Normen und Methoden der Kirche zu verwechseln. Was bei den synodalen Versammlungen diskutiert wird, sind nicht die traditionellen Wahrheiten der christlichen Lehre. Die Synode befasst sich vor allem damit, wie Lehre in den sich wandelnden Kontexten unserer Zeit gelebt und angewendet werden kann.»[1] Synodalität als geistlicher Weg, als Weg von Gemeinschaft, Teilhabe und fokussiert auf die Sendung, hat aus seiner Sicht also eher mit dem Wie des Kircheseins zu tun, nicht mit Glaubensinhalten. Wie kann heute der Glaube mit eben seinen Inhalten selbst so bezeugt werden, dass Menschen ihn in seiner heilsamen Kraft lernen und annehmen können, dass Menschen von der barmherzigen Liebe Christi berührt werden? Wie können in dieser Mission der Kirche möglichst viele eingeladen, mitgenommen und beteiligt werden? Und wie können wir miteinander so auf Gottes Geist und Gottes Wort hören und den Glauben feiern, dass neue Fruchtbarkeit daraus erwächst?
Die Frage nach Realpräsenz und Sakrament
Dass aber beim Synodalen Weg fundamentale Glaubensinhalte zur Disposition stehen, auch wenn das nicht in dieser Zentralität formuliert oder womöglich auch von vielen nicht erkannt wird, soll nun noch erläutert werden. Zu Beginn des Synodalen Weges war ich als eine von vier Personen bei der geistlichen Einstimmung auf den Weg aufgefordert worden, in wenigen Sätzen zu erläutern, warum ich glaube, warum ich mich in der Kirche engagiere und warum ich beim Synodalen Weg mitmache. Mein Statement lautete wie folgt:
Ich glaube, weil ich überzeugende Menschen des Glaubens kennenlernen durfte und weil ich die Wahrheit von der erlösenden Gegenwart Jesu selbst erlebt habe. Sie hat mein Leben verändert. Ich engagiere mich in der Kirche, weil ich sie glaube als von Gott erwählter Wohnort seiner Gegenwart. Ich will in der Kirche Gott verherrlichen und wünsche mir, dass möglichst viele Menschen durch den Dienst der Kirche berührt werden von der liebenden und befreienden Gegenwart des Herrn. Deshalb auch ist für mich die so genannte Realpräsenz das alles entscheidende Thema für unsere Kirche. Es geht nicht einfach nur um eine Botschaft des Evangeliums in Worten. Vielmehr ist die gute Botschaft die, dass der Herr selbst tatsächlich anwesend ist, dass er liebt, dass er vergibt – und dass er mit seiner Liebe uns und die Welt verändern will. Eine Antwort darauf, ein Vertrauen-können, dass er wirklich da ist, erlöst und befreit uns. Und sie befähigt uns mehr und mehr zu einer Liebe, die der Seinen ähnlicher wird.
Die grundlegende Krise der Kirche liegt daher aus meiner Sicht in der von sehr vielen erlebten und von sehr vielen auch geglaubten grundsätzlichen Abwesenheit Gottes. Das hat zur Folge, dass sich das Evangelium häufig nur mehr auf bloße Worte, Sätze und Gedanken reduziert. Wenn es so ist, dann hat das Evangelium auch keine existenziellen, verändernden Auswirkungen mehr auf unsere Menschenherzen. Auch die Krise, die durch die Erkenntnis des Ausmaßes von sexuellem Missbrauch über uns gekommen ist, hängt aus meiner Sicht – neben anderen Faktoren – in der Tiefe mit einer faktisch geglaubten oder erlebten Abwesenheit Gottes zusammen. Wenn also die Mystik fehlt, das heißt, die Erschließung von Erfahrungsdimensionen von Jesu Anwesenheit, reduziert sich Kirche notwendig auf Moral oder einen bloßen Humanismus der Nettigkeit oder auf den Versuch des Relevanzgewinns durch bloß strukturelle Veränderungen. Oder schlimmer noch: Entleerter Glaubensinhalt und Struktur werden benutzt und missbraucht, um nur mehr Eigeninteressen zu verfolgen.
Die Gefahr der Konzentration auf strukturelle Änderungen sehe ich auch für den Synodalen Weg und bin deshalb dankbar um das Wort des Papstes, der auf den nötigen Primat der Evangelisierung auf diesem Weg hingewiesen hat. Und ich bin dankbar, dass der Weg auch geistlich begleitet und eingerahmt ist. Ich wünsche mir aber, dass eben dies mehr sein wird als ein geistliches Feigenblatt.
Ich engagiere mich beim Synodalen Weg, weil ich als Mitglied der Deutschen Bischofskonferenz zugesagt habe, in ein ehrliches und offenes Gespräch einzutreten über die Folgen des Missbrauchs und über die Fragen, wie sich Kirche aus solchen Erkenntnissen heute erneuern kann. Meine Hoffnung ist, dass auf diesem Weg auch die Anwesenheit unseres Herrn erfahrbar wird und sie uns alle in unserem Glauben und in unserem Ringen um Einheit stärkt.
Die in diesem Statement angesprochene Realpräsenz findet in unserer Kirche ihre objektive Manifestation vor allem in ihrem sakramentalen Charakter. In der Kirche als Ganzer ist Christus da, in den Sakramenten, insbesondere in der Eucharistie in unübertroffener Dichte. Wenn dem aber so ist, und wenn diese Anwesenheit Christi zugleich liebende, vergebende, heilende Zuwendung zu den Glaubenden ist, dann ist die gläubige Disposition, die vertrauensvolle Offenheit der Menschen für diese Zuwendung ebenfalls wesentlich, damit liebende Anwesenheit Gottes ins Ziel finden kann, ins menschliche Herz und ins Herz einer gläubigen Gemeinschaft. Lässt sich der Mensch auf diese dialogisch angelegte Präsenz ein («Selbstmitteilung Gottes»), kehrt er um, wächst er darin, gibt er der Gegenwart Gottes mehr und mehr in sich selbst den Raum, den Gott im Grunde schon mit der Taufe beansprucht, dann wird der Mensch selbst immer mehr ein Quasi-Sakrament, das heißt Realsymbol der Anwesenheit Gottes in dieser Welt. Das II. Vatikanische Konzil hat in diesem Sinn formuliert, dass alle Gläubigen zur Heiligkeit berufen sind (LG 5), also zur personalen Repräsentation der Realpräsenz, zur liebenden Vergegenwärtigung der Barmherzigkeit Gottes in der Welt.
Nun besteht eine der Krisen der Kirche in unserem Land in ihren dramatischen Säkularisierungsschüben, was mit einem massiven Rückgang der sakramentalen Praxis einhergeht. Insbesondere der Besuch der sonntäglichen Eucharistie ist in Richtung 5-Prozent-Marke der nominellen Katholiken gerutscht und die Wahrnehmung des Sakraments der Versöhnung in kaum mehr quantitativ erfassbare Bereiche – wenn man von einzelnen Wallfahrtsorten oder Klöstern einmal absieht. Die Erkenntnisse des sexuellen Missbrauchs verschärfen diese Krise noch einmal dramatisch, weil heilsame Realpräsenz durch diejenigen, die als Priester «in persona» des real präsenten Christus handeln, tatsächlich zur Unheilspräsenz für die Betroffenen wurden. Das Realsym-bol «priesterlicher Mensch» wird zum real erfahrenen Dia-bol – und untergräbt dramatisch den Glauben an Gottes Gegenwart in seinen verantwortlichen Repräsentanten und damit in der Kirche insgesamt.
In der systematischen Theologie ist es üblich geworden, Christus selbst als Ur-Sakrament zu bezeichnen, als der, in dem selbst im tiefst möglichen Sinn Gottes Anwesenheit erfahrbar wurde (Joh 14,9: «Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen»; Joh 2,19: «Reißt diesen Tempel (den seines Leibes!) nieder, in drei Tagen richte ich ihn wieder auf»). Und die Kirche nennt man von Christus her: Grundsakrament. Sie ist nämlich (so LG 1) «in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit.» Diese «innigste Vereinigung» ist zugleich Zielgestalt aller Bundesschlüsse Gottes mit den Protagonisten seines Volkes im Alten Bund und schließlich mit der ganzen Menschheit in Christus. Sie ist durchgehend durch die Schrift immer wieder im Bild einer Hochzeit geschildert, in der der göttliche Bräutigam sich mit seiner Braut vermählt. Während umgekehrt das abtrünnige Volk im Alten Bund immer wieder auch als Dirne (vgl. Jes 1,21; Ez 16,15ff) bezeichnet wird, die von Gott phasenweise verstoßen wird – damit sie sich läutere und umkehre.
Der Zusammenhang zwischen Kult und sittlichem Leben in der Schrift
Wenn nun auch der einzelne Mensch und der Mensch in Gemeinschaft tatsächlich berufen ist, als Antwortender von Christus her Sakrament zu sein und zu werden, dann bedeutet das: Er drückt vor allem durch seine leibliche Verfassung hindurch – und dargestellt durch sie – die liebende Realpräsenz Gottes in allen seinen Vollzügen aus. Er ist, je mehr von dieser Anwesenheit bestimmt, in bestimmten Sinn je mehr ganz geworden, tiefer integriert. Leib und Geist, Wollen, Denken, Fühlen, Begehren etc. sind in einer erneuerten, heiler gewordenen Personmitte (biblisch: Herz) zusammengeführt, geeint – soweit dies in einer bleibend gebrochenen Verfassung von einem sterblichen Menschen in vergänglicher Welt eben möglich ist. Grenzen einer gänzlichen Erneuerung schon in dieser Welt formuliert etwa Paulus in Röm 7: In ihm, in Paulus selbst, wohnt offenbar bleibend so etwas wie «Fleisch» und «Sünde» als die Wurzel von menschlicher Desintegration, die daher vollständige Integration in diesem Leben verhindert. Erst im gläubigen Durchgang durch den leiblichen Tod wird dem Menschen die ursprüngliche und erneuerte «Herrlichkeit» (Röm 8,18) und vollständige «Ähnlichkeit» (1 Joh 3,2) mit Christus zuteil. Der geschenkte Geist aber bleibt in dieser Welt das «Angeld», der «erste Anteil des Erbes» auf diese Herrlichkeit hin.
Bleibt also durch diesen Geist die Berufung des Menschen, selbst heil und heilig zu werden trotz dieser Einschränkung gültig und herausfordernd, dann bekommt damit auch der Akt der liebenden Ganzhingabe in der sexuellen Vereinigung von Menschen notwendig sakramentalen Charakter. In der Schöpfungserzählung bekommt das erste Menschenpaar in seiner Gottebenbildlichkeit den Auftrag zur Ein-Fleisch-Werdung und zur Vermehrung noch vor dem Sündenfall (vgl. Gen 1,28; 2,24f), ist also Teil dieser ursprünglichen Erfahrung in einer heilen Welt, die durchgehend von Gottes Gegenwart getragen ist. Der Sündenfall wird folglich wie ein Heraustreten des Menschen aus einer ursprünglich selbstverständlich erfahrenen Realpräsenz Gottes im menschlichen Leben geschildert. Und daher sind die Folgen dieses Verlustes der Erfahrung von Gottes Gegenwart – im Bild das Verlassens des Paradieses – gerade auch für den Drang des Menschen zur sexuellen Aktivität ebenso gravierend. Diese gerät unter den Einfluss der ab hier negativ konnotierten Begierde und des Strebens nach Macht (vgl. Gen 3,16); sie löst sich aus dem ursprünglich als heilig (eben sakramental) gedachten Auftrag Gottes heraus und verselbständigt sich hinein in vielfältige Ausdrucksformen eines durch die Begierden «unreinen Herzens» mit «entehrenden Leidenschaften», wie Paulus eine solche Entkoppelung im Römerbrief beschreibt (vgl. Röm 1,24ff). Letztlich wird der Mensch, der Gott zwar erkennen könnte, ihn aber weder ehrt noch ihm dankt, ein Wesen mit «verfinstertem Herzen», ichsüchtig und kaum mehr liebesfähig im von Gott gemeinten Sinn (vgl. Röm 1,21ff).
Paulus zeichnet hier in knappen und intensiven Strichen ein biblisches Motiv nach, das sich durch die gesamte Schrift zieht: Nicht geübte oder verfehlte Gottesverehrung (Götzendienst) führt immer neu zur Verkehrung des Verhaltens im Bereich der Sexualität (häufig als: «Unzucht») und umgekehrt: Sexuelles Fehlverhalten führt zur Verkehrung des Kults, zur Verkehrung der rechten Gottesverehrung. Nur beispielhaft für eine lange mögliche Liste: Der Götzendienst mit Tanz ums Goldene Kalb, Ursünde Israels, führt zu unzüchtigem Verhalten (vgl. Ex 32, 6; 1 Kor 10, 8) der beteiligten Götzendiener. Die sexuellen Ausschweifungen Davids und Salomos führen zu familiären Katastrophen, Zerbruch des Reiches, Zerbruch des Kultes und zum Götzendienst. Die Priestersöhne Elis, Hofni und Pinhas vernachlässigen den Kult und sind Täter sexuellen Missbrauchs (1 Sam 2,17; 2,22) – was letztlich zur familiären Katastrophe und zum Verlust der Bundeslade führt (1 Sam 4). Der Priester Esra will nach der Babylonischen Gefangenschaft den Tempel wieder aufbauen und die kultische Reinheit wiederherstellen, wird aber mit dem Problem der Mischehen der Menschen und dem dadurch praktizierten Götzendienst konfrontiert. Die Reinheit des Kultes fordert für ihn daher die Auflösung der Mischehen (vgl. Esra 10,3). Der Autor des Weisheitsbuches bringt den Zusammenhang in seiner Weise auf den Punkt: «Das Ersinnen von Götzenbildern war Anfang der Untreue, ihre Erfindung führte zur Sittenverderbnis» (Weish 14,12). Oder im hier angezeigten Problem ausgedrückt: Ein fehlendes gläubiges Ernstnehmen des real gegenwärtigen Gottes, der mich anspricht und daher anspruchs-voll ist, macht diesen Gott dann notwendig zu einem mir verfügbaren Götzen – dessen Maß an Anspruch ich dann ebenfalls selbst bestimmen kann.
Jesus selbst macht dann auch deutlich, dass das ursprüngliche, auch sexuelle Zueinander von Mann und Frau eine ursprünglich so gewollte Zusammenführung durch Gott war, womit diese Vereinigung schon im Ursprung so etwas wie Sakrament war und ist: «Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen» (Mk 10,9). Und es ist lediglich die «Hartherzigkeit» des Menschen, die Mose zum Zugeständnis der Möglichkeit von Scheidung bewegte (vgl. Mt 19,8). Jesus ist aber gekommen, uns ein «neues Herz» zu geben, eines «von Fleisch», nicht «von Stein» (Ez 36,26). Wenn also der Mensch selbst berufen ist, Sakrament zu sein und wenn zugleich auch die Kirche als Sakrament «innigster Vereinigung» von Gott und Menschheit beschrieben wird, wenn die Schrift Christus und Kirche als Braut und Bräutigam beschreibt, dann ist für den Sinn von Sexualität aus ihrem Ursprung her ebenfalls «innigste Vereinigung» gemeint und damit eben auch Treue, Dauerhaftigkeit und Fruchtbarkeit. Dass Freude, Glücks- und Lusterfahrung damit einhergehen, ist übrigens auch schon im Schöpfungsbericht angezeigt (vgl. Gen 2,23). Wieder ist es dann Paulus, der vor allem im Epheserbrief die menschliche Ehe und das Verhältnis von Christus und Kirche tief aufeinander bezieht (Eph 5,32).
Die Plausibilität dieser Überlegungen vorausgesetzt, bedeutet dies nun: Sakrament ist die sexuelle und darin zugleich auf das ganze Leben zielende Vereinigung der Menschen von Gott her – und sie ist es unter bestimmten Bedingungen, nämlich unter den genannten Bedingungen ihrer Rückführung in den Ursprung, die die Realpräsenz Gottes in diesem Akt ernst nimmt und bejaht. Und die deshalb auf Einheit, Treue und Fruchtbarkeit hin angelegt ist. In diesem Sinn sind dann die Ehe und die darin gelebte Sexualität «heilig», geheiligt durch Gott und im Ursprung von ihm so gemeint, das heißt theologisch auch: offenbart. Weil nun aber das Wort «Sakrament» eine theologische Wirklichkeit des Neuen Bundes bezeichnet[2], kennt die Kirche dennoch die Wirklichkeit der Ehe auch unter Ungetauften als eine Art natürliches Sakrament (als einziges unter den sieben mit dieser Analogie!), eben als «Naturehe» – weil Ehe und Sexualität ursprünglich von Gott her so angelegt waren und sind – auch dort, wo Menschen noch nicht zu Christus gefunden haben und getauft wurden. Hier liegt deshalb auch einer der Gründe, warum wir das so genannte Naturrecht und ein damit verbundenes naturrechtliches Denken nicht so schnell wie von vielen gewünscht hinter uns lassen können. Denn die Kategorie der Sakramentalität ist insbesondere hier zutiefst mit dem naturrechtlichen Denken verbunden. Gott wirkt sakramental, das heißt eben in natürlichen, auch materiellen und leiblichen Gegebenheiten. Die Fleischwerdung des Gottessohnes – als Mann in einer und durch eine Frau (vgl. Gal 4,4) – und die Auferstehung des Fleisches in ihm sind deshalb nicht zu umgehende Angelpunkte des Heils.
Bekehrung des Herzens?
Ich habe dies an sich Bekannte noch einmal in dieser Knappheit dargelegt, weil ich glaube, dass sich die inhaltlichen Weichenstellungen beim Synodalen Weg in allen vier Foren direkt oder indirekt auf Sexualität und/oder das Verhältnis der Geschlechter zueinander beziehen – und dass sie damit womöglich, ohne es deutlich zu sagen oder auch ohne es zu sehen (oder ohne es sehen zu wollen?), letztlich die sakramentale Verfassung der Kirche wenigstens antasten oder in der Konsequenz auf lange Sicht sogar aushöhlen. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist in den bisherigen Überlegungen und Texten des Synodalen Weges der weitgehende Ausfall der Formulierung eines Anspruchs des real präsenten Gottes. Ist Gottes Selbstgegenwart zugleich Selbstmitteilung, dann ist sie immer zuerst Zuspruch, immer zuerst Gabe – und dann aber notwendig auch Anspruch an den Menschen, weil sie eben immer Gabe ist, die Annahme erhofft und damit Aufgabe ist. Es gibt aber keine echte Annahme der liebenden Selbstmitteilung Gottes ohne Umkehr, ohne die Rückwendung und neue Zuwendung des Menschen zu dem sich offenbarenden und schenkenden Gott. Es gibt auch keine sich als wirksam erweisende eucharistische Kommunion ohne das aus dem Herzen kommende, antwortende «Amen» des empfangenden Menschen. Gott ist Liebe – und Liebe kann per Definition niemanden zwingen. Daher ist «Vergebung der Sünden» biblisch auch die nicht zu eliminierende, zentrale Wirklichkeit der Erlösungstat Christi: Befreiung aus der Macht der Sünde, aus der Macht des Begehrens nur dieser Welt (vgl. 1Joh 2, 16) und Hineinholen in die neue, wieder real präsente Beziehungswirklichkeit der Gottesfamilie, Befähigung zur fortwährenden und existenziellen Antwort, Lernen einer Liebe, die absichtslos, nicht manipulativ und nicht besitzergreifend – die also in diesem weiten Sinn verstanden: keusch ist.
Meines Erachtens fehlt in den Texten des Synodalen Weges vielfach diese Perspektive – und damit wird ein Hauptproblem seiner Zielrichtung deutlich. Es wird zwar immer wieder von Umkehr gesprochen, aber verstanden wird damit in der Regel zuerst eine Art Umkehr der Kirche in ihren Strukturen. Kirche müsse verstehen, dass ihre Strukturen zur Ermöglichung von Sünde (besonders von Missbrauch) geführt hätten und Evangelisierung verhinderten, daher müssten sich die Strukturen verändern. Diese fehlerbehafteten Strukturen seien insbesondere die alleinige Macht in Händen der Kleriker, demgegenüber die Ohnmacht der Frauen und der Laien und eine Sexualmoral, die entweder nur noch relevanzlos für die Menschen sei oder aber beim Versuch sie zu beachten zu seltsamen Pervertierungen führt – und damit ebenfalls Missbrauch begünstigt. Daher müsse insbesondere die Sexualmoral an die heutige Lebenswirklichkeit samt den Erkenntnissen der Humanwissenschaften angepasst werden. Der individuelle Glaube der Menschen wird dagegen immer schon vorausgesetzt, und kaum angefragt, weder inhaltlich noch in seiner Entschiedenheit oder Intensität. Fehlende Einheit inhaltlicher Positionen mit dem Lehramt werden grundsätzlich als positive Erscheinung von Pluralität gerechtfertigt; Heiligkeit oder gar Martyrium als Vollendungsgestalt christlichen Lebens kommen im Grunde nicht mehr vor.
Allerdings: Richtig an einer solchen Analyse der Strukturen, die möglicherweise Missbrauch begünstigen, ist aus meiner Sicht tatsächlich dies: Wenn die Kirche in allen ihren Gliedern weitgehend des Glaubens an die verändernde Kraft der realen und den Menschen heiligenden Präsenz Gottes verlustig geht, dann neigen in der Folge davon Strukturerscheinungen, zu leeren Hüllen und Fassaden zu werden; dann bleibt auch kirchliche Lehre vor allem überforderndes Gesetz und bloße Moral; dann bleibt der kirchliche Apparat immer nur geneigt zum Selbst- und Machterhalt und versucht, besonders das zu vertuschen, was diesen Selbsterhalt gefährden könnte. Und dann streben diejenigen in Verantwortung ebenfalls zu einem größeren Interesse an Selbst- und Machterhalt und weniger zur von Jesus geforderten Selbsthingabe für ihn und die Menschen. Es ist im Grunde das Bild einer narzisstischen Kirche, die zuvorderst um sich selbst besorgt ist. Und wenn wir ehrlich sind, ist vieles an dieser Diagnose richtig.
Nicht zuletzt deshalb sind in den letzten Jahren gerade auch die Strukturen der Kirche in Deutschland unter dem Eindruck des Missbrauchs bereits in vielfacher Hinsicht angepasst und verändert worden: So gibt es allerorts umfangreiche und durchgreifende Präventionsmaßnahmen, eine immer neu angepasste Interventionsordnung, Aufarbeitungskommissionen und Betroffenenbeiräte in den Bistümern, Maßnahmen zur Anerkennung des Leides, der nach Rom eingesandte, ausgearbeitete Vorschlag, eine eigene Verwaltungsgerichtsbarkeit, Disziplinarordnung und Strafkammern einzurichten; die Verabschiedung einer Ordnung für die Führung von Personalakten, unabhängige Ansprechpartner und anderes mehr.
Zielt der Synodale Weg aber als mögliche Antwort auch auf eine aufrichtige Umkehr, auch von jedem persönlich? Eine Bekehrung, die lernt, ihre Sünden zu bekennen und ihr Herz der Gegenwart des Auferstandenen so zuzuwenden, dass Menschenherzen verändert werden? Oder ist unsere gläubige Vorstellungskraft dafür inzwischen in der Breite des Kirchenvolkes so gering, dass wir noch mehr vor allem äußere strukturelle Bedingungen so verändern müssen, dass sie einer uns vertrauten liberalen, demokratischen Gesellschaft ähnlicher werden und dann eben auch der persönlichen Lebenswelt der vielen in so einer Gesellschaft? Um durch mehr Kontrolle der Mächtigen, durch garantierte Mitbestimmungsmöglichkeiten von allen und Liberalität in Liebesdingen womöglich einige missbrauchsbegünstigende Faktoren zu eliminieren? Aus meiner Sicht wäre gerade dann aber noch nichts von der Anziehungskraft sakramentaler Gegenwart Gottes gewonnen. Vielmehr droht gerade deren Verlust. Warum? Weil in den Themen der vier einzelnen Foren des Synodalen Weges die Frage nach der verändernden und heiligenden Realpräsenz Gottes direkt mit der gewünschten Veränderung der Themenstellungen zusammenhängt. Dies sei im Folgenden noch im Ansatz gezeigt.
Die Foren und ihre Themen
Das Forum «Macht und Gewaltenteilung» kreist unter anderem oder auch vordringlich um die Frage, inwiefern im Bischofsamt und bei Pfarrern die Leitungsmacht etwa im Blick auf Verwaltung, Jurisdiktion, Personal und Finanzen ihre Grundlegung hat von den drei geistlich konnotierten Diensten (munera) des Lehrens, Leitens und Heiligens her, die bei der sakramentalen Weihe in den Ordo übertragen werden. Oder ob sie auch davon gelöst werden und so etwa auch Bischöfe und Pfarrer einer größeren Kontrolle unterzogen werden könnten. Müssen letztverantwortliche Leiter immer und für alles Bischöfe und Pfarrer (in den Pfarreien) sein? Oder können sie auch kontrolliert werden? Kann Leitung und Verantwortung besser geteilt, delegiert und auch abgegeben werden? Ich bin persönlich selbstverständlich dafür, dass diese Fragen offen diskutiert werden, und sehe hier guten Spielraum für erweiterte und neue Formen der Teilhabe und nötiger Kontrolle.[3] Weiten Teilen des schon verabschiedeten Grundtextes aus Forum I kann ich daher zustimmen, anderen nicht.[4]
Allerdings ist es aus meiner Sicht nun kein Zufall, dass dann im Forum II («Priesterliche Lebensform») durch das Votum der Synodalversammlung erstens die grundsätzliche Frage diskutiert werden soll, ob und wozu es überhaupt den priesterlichen Dienst benötige.[5] Zudem wird deutlich, dass die Debatten im Forum I («Macht und Gewaltenteilung») auch in die anderen Forumsthemen hineinreichen – und eben dadurch deutlich machen, dass es letztlich doch um die Sakramentalität als von Gott geschenkte Realpräsenz geht: In den Abschnitten 8.2. und 8.3. geht es nämlich um die Zugangsvoraussetzungen zum Ordo, angesprochen werden hier explizit Zölibat und Frauenordination. Zölibat ist eigentlich Thema des Forums II und der Zugang von Frauen zu Ämtern Thema des Forums III.
Tatsächlich erleben wir unter heutigen gesellschaftlichen Bedingungen im Westen nicht so selten ein Scheitern zölibatären Lebens unter Priestern. Und dort, wo er nicht von innen her wirklich angenommen wird, sondern womöglich als Ausweich-Lebensform von unreifen Personen gesucht wird, die sich ihrer Sexualität oder ihrer wie auch immer gearteten sexuellen Orientierung nicht stellen wollen oder können, kann der Zölibat wohl tatsächlich sexuellen Missbrauch begünstigen.[6] Geistlich gesprochen ist der Zölibat deshalb aus meiner Sicht nur plausibel unter der gläubigen Einsicht, dass ein Leben aus der realen Gegenwart Christi im eigenen Leben erfüllt und fruchtbar sein kann. Ein geweihter Priester ist im gelingenden Fall ein Zeuge, mithin ein Zeuger, ein Vater (Pater, Father, Padre, wie Priester in vielen Ländern der Welt genannt werden); ein Zeuger jenes neuen Lebens, das der Auferstandene in Person ist und ins Herz der Menschen bringen will. Das heißt: Damit ein Priester gelingend zölibatär leben kann, muss er in der Lage sein, seine innere Personmitte, sein Herz in der realen Präsenz des Herrn zu verankern und sehr konkret aus ihr zu leben. Die Standesbezeichnung eines «Geistlichen» kommt aus dieser ursprünglichen Wahrnehmung des «Stehens» im Raum dieser geistlichen Wirklichkeit. Gelingt diese Lebensform, ist sie ein positiv provokatives Zeichen dafür, dass Gott tatsächlich im Leben eines Menschen wirkungsvoll da ist und es zur Erfüllung bringen kann. Der Zeuge wird inmitten der Kirche zum zeugenden Mitwirker des göttlichen Lebens im anderen Menschen.
Umgekehrt: Dieser gemeinsame Verzicht unter Priestern auf gelebte Partnerschaft, verbunden mit Macht und Privilegien, lässt ohne die aufrichtig gelebte innere Mitte die Kleriker leicht dazu geneigt werden, untereinander zur «geschlossenen Kaste» zu werden, die meinen, ihre Privilegien durch ihren Lebensstil zu verdienen – und dann die Dinge ausschließlich unter sich «zu regeln» – und damit eben unter anderem auch Missbrauch zu vertuschen oder im schlimmsten Fall gegenseitig zu begünstigen. Hier sieht das gläubige Volk völlig zurecht die Gefahr einer dramatischen Verweltlichung, die fast notwendig Macht und Menschen missbraucht: Corruptio optimi pessima. Wieder stellt sich die Frage: Wie lebt ein Mensch, der die Lebensform Jesu für sich übernimmt, konkret aus der realen Präsenz seines Herrn? Und inwiefern sind die weibliche konnotierte Kirche und «ihre Kinder» (vgl. Offb 12,17) dafür auch ein Gegenüber, realer Ort seiner Hingabe als betender und liebender Mensch?
Was die Frage nach dem Zugang zum sakramentalen Priestertum für Frauen angeht (Forum III): Wenn die innere Form des Erlösungsgeschehens eingezeichnet ist in das Verhältnis von Bräutigam und Braut, wenn es also kein nur biologischer Zufall war, dass Christus als Bräutigam Mann und die Urgestalt von Kirche als Braut eine Frau ist (Maria), sondern in das Geheimnis von Schöpfung und Erlösung hineingehört, dann wird die Kirche auch in Zukunft als Vorsteher bei der Eucharistie, dem «Hochzeitsmahl des Lammes», keine Frau weihen können – während die Frage nach dem Diakonat der Frau aus meiner Sicht offen ist und lehramtliche Klärung braucht. Aber gerade in der Eucharistie zeigt sich, wie oben schon ausgeführt, die ursprünglichste Form der sakramentalen Gegenwart Gottes als Selbstmitteilung von Christus an seine Braut, die Kirche. Wie gesagt: Die ursprüngliche Form schöpferischer, sakramentaler Realpräsenz ist dialogische, insbesondere bräutliche Realpräsenz – Hingabe Jesu an seine Kirche!
Schließlich ein letztes, die Sexualmoral (Forum IV): In der Schrift wird vielfach bezeugt, dass die reale Begegnung mit Jesus verändert. Und sie wirkt diese Veränderung auch im Bereich des Lebens der Sexualität. Der «neue Mensch», als die «neue Schöpfung» (2 Kor 5,17) kann die Sprache des Leibes so leben lernen, dass er mitten in einer gebrochenen Welt dem Liebesgebot Gottes und seiner Gegenwart entspricht (vgl. 1 Kor 6,15–20). Das heißt: Er wird von Gott her mehr und mehr «ganz» und lernt im Leben mit Gott seine Sexualität mit ihrer Sehnsucht und Begierde so zu integrieren, dass er sie in dem Ort lebt, in den sie ursprünglich ganz gehört, in der Ehe mit ihrer Hinordnung auf Bindung, Treue, gegenseitige Freude und Offenheit auf Nachkommen. Oder eben so, dass er auf ihr Ausleben verzichtet. Der vorgeschlagene Grundtext des Synodalforums IV spricht sich nun aber dafür aus, die verschiedenen Dimensionen von Sexualität (etwa Bindung, Lust, Transzendenz, Zeugung) jeweils für sich zu nehmen und in ihr je eigenes Recht zu setzen, ohne ihren inneren Zusammenhang allzu notwendig erscheinen zu lassen. Aus meiner Sicht wird hier die Erkenntnis zur nötigen Umkehr in ein durch die Realpräsenz Gottes erneuertes und in größere Ganzheitlichkeit berufenes Leben verdrängt durch vor allem horizontal gewonnene humanwissenschaftliche Erkenntnisse und die Berücksichtigung lebensweltlicher Normalität: Also Bestätigung der vorfindlichen Desintegration des Menschen als eine Art von Normalität in diesem Bereich. Dazu kommt ein Verständnis von der Freiheit des Menschen, das sich vorwiegend an modernen philosophischen Konzepten oder faktisch gelebten Freiheitsvollzügen orientiert, aber nicht an ihrer biblischen bzw. paulinischen Auffassung: «Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe!» (Gal 5,13).
Wird aber von hier in den Anträgen des Synodalen Weges der Segen, das heißt der Zuspruch Gottes, gefordert ganz generell für alle möglichen «Paare, die sich lieben» und die den Segen wünschen, was selbstverständlich sexuelle Aktivität ausdrücklich einschließt, dann bleibt meines Erachtens von dem biblischen Aufruf zur Umkehr, zur Integration, zur Teilhabe am neuen Leben auch in diesem Bereich nicht mehr allzu viel übrig. Was «Liebe» ist und welche Formen von Liebe Läuterung brauchen, erschließt sich uns als Christen ja gerade erst von der gekreuzigten Liebe her, also von diesem hochzeitlichen Hingabegeschehen, das das Herz des Neuen Bundes ist. Das heißt, dass so vieles, was in dieser gebrochenen Welt, und damit auch in der viel beschworenen Lebenswelt der Menschen oder auch der wissenschaftlichen Analyse von Sexualität, unter dem Stichwort «Liebe» verhandelt wird, im Grunde aus der Sicht des Glaubens ebenfalls Läuterung braucht: Von der Besitzergreifung zur Freigabe, von der Begierde «für mich» zur Hingabe «an dich», letztlich – im Bild des Paulus auf Christus hin gesprochen – vom Gekreuzigt- und Begrabenwerden zur Auferstehung (vgl. Röm 6,4–6,6). Und wenn es den dargelegten inneren Zusammenhang zwischen rechtem Kult und rechtem sittlichen Verhalten gibt, dann fürchte ich, dass sich unsere Gläubigen, die diesen jetzt im Synodalen Weg vorgeschlagenen Begründungsmodellen für menschliche Sexualität folgen, eher noch weiter aus der geglaubten, erfahrbaren Realpräsenz Gottes entfernen und die Antwortversuche womöglich immer noch schwächer werden. Eben weil sich der Mensch selbst von seiner Berufung verabschiedet, «Realsymbol» der real präsenten, hochzeitlichen Liebe Gottes zu werden.
Weichenstellung zu einer anderen Kirche?
Dazu noch eine Beobachtung zu den entscheidenden Weichenstellungen. Im Forum IV, dem ich selbst angehöre, konnte ich zu Beginn des Weges mit einigen anderen zusammen einen grundlegenden Text als Diskussionsbeitrag eingeben[7], der der biblischen Anthropologie nach meinem Verständnis entspricht – und wie ich es hier noch einmal knapp dargelegt habe. Wir haben darin auch ein Freiheitsverständnis formuliert, das dem hier kurz entfalteten entspricht: Der von Christus erlöste Mensch ist in der Lage, in der inneren Nähe und getragen vom real präsenten Christus in seiner Kirche in eine immer größere Freiheit von Sünde und in die Freiheit zur Gotteskindschaft hineinzuwachsen – die ihn dann wieder zur größeren Hingabe befähigt. Dieser Text wurde diskutiert – wenn auch nicht allzu ausführlich. Die große Mehrheit der Forumsteilnehmer hat sich dann aber schnell für einen anderen Ansatz und ein anderes Kriterium im Blick auf die Freiheit entschieden, der folgendermaßen formuliert wurde: Sie «betonen stärker den Aspekt der ‹verantwortlichen Freiheit› im gewissenhaften Urteil jeder einzelnen Person. Das Gewissen wird angeleitet und begleitet durch das gemeinsame Suchen und Ringen mit anderen und nicht zuletzt durch die Lehren der Kirche.»[8] Nichts an dieser Formulierung ist zunächst verkehrt, dennoch bedeutet sie eine Weichenstellung, die den hier entfalteten Aspekt von der erlösenden Realpräsenz Jesu in seiner Kirche letztlich dem persönlichen Gewissensurteil nachordnet und umgekehrt die «Lehre der Kirche» eben vor allem in der Form von «Lehre», d.h. in Form von Sätzen auch noch mit berücksichtigt («nicht zuletzt»), wie eben andere auch. Aber ein seinsmäßig tragendes Vorweg von Christus in seiner Kirche[9], aus dem heraus ich neu werden kann, neu geboren werde, mithin neue Freiheit empfange, ist hier nicht beschrieben. Stattdessen eine schon vorweg eher autonom gedachte Freiheit, die sich aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Erfahrungen und Erkenntnissen ein Gewissensurteil bildet – und dabei das Urteil des Lehramtes auch noch kritisch mit einbezieht.
Ist diese grundlegende Weichenstellung in Sachen Freiheitsauffassung aber einmal vorgenommen, wird deutlich, dass sich der fortfolgende Grundtext dann vor allem auf dieses Freiheitsverständnis jenseits von oder unabhängig von der Erfahrung oder dem Bewusstsein von «Realpräsenz in Christus» stützt. Es gibt dann von hier kein leichtes Zurück mehr. Die grundlegende Bekehrung des Herzens hin zum Neuen Menschen in der Kirche – aufgrund der Erfahrung des Befreit-seins aus Gottesentfernung – kommt daher existenziell kaum mehr zum Tragen und spielt in den weiteren Formulierungen des Textes kaum noch eine Rolle. Das heißt folglich, nach dieser Weichenstellung war die Erfahrung von uns eher konservativen Teilnehmern am Forum: Wir fühlten uns abgehängt. Jede weitere Form eines intensiveren Mitdiskutierens hätte immer wieder an diesem Grundlegenden ansetzen müssen, der ganze Textentwurf hätte also wieder eine andere Richtung bekommen müssen, als es die weite Mehrheit wollte. Wir waren damit mehr oder weniger raus aus der Debatte.
Interessant war dann auch die folgende Erfahrung: Im Gespräch mit Mitgliedern anderer Foren, insbesondere der Foren I (Macht) und III (Frauen und Ämter), erfuhren wir, dass es den Minderheiten in diesen Foren ähnlich erging. Die meisten fühlten sich aus der Diskussion ausgeschlossen, weil die Grundtextentwürfe irgendwann tatsächlich eine Grundentscheidung für eine bestimmte Richtung getroffen hatten. Nach meinem Verständnis liegt das eben genau an dem, was ich hier zu entfalten versucht habe: An einem sakramentalen und dialogisch-bräutlichen Verständnis von Realpräsenz Gottes in seiner Kirche – als dem uns immer schon voraus liegendem «Raum» dieser Gegenwart. Das heißt folglich auch: Die Neuformulierungen von Lehre sind daher aus meiner Sicht nicht einfach Weiterentwicklung, schon gar nicht «behutsame» Weiterentwicklung, wie es auch manche Bischöfe sehen wollen, sondern tatsächlich eher ein Bruch. Sie sind nicht graduell zur bestehenden Lehre Ergänztes, sondern wesenhaft Anderes. Und da es sich im Kern um fundamentale anthropologische Fragen handelt, entfaltet sich aus der Anthropologie folgerichtig eine andere Ekklesiologie und verbunden damit natürlich folglich zum Beispiel auch eine andere Gnaden- und Erlösungslehre.
Der Zusammenhang zwischen Anthropologie und Ekklesiologie ist aber insbesondere im Konzilstext Lumen Gentium deutlich sichtbar: Wo Kirche von sich selbst gleich zu Beginn (LG 1) als Sakrament spricht, gipfelt der ganze Text am Ende, im 8. Kapitel, in einer Mariologie. Die Urgestalt von Kirche ist der heile, personale und bräutliche Ort der Realpräsenz des Herrn, die «Wohnung Gottes unter den Menschen» (Offb 21,3). Wenn ich recht habe, dann sind diese Weichenstellungen in den Foren, die die Kirche als Ort dieser Realpräsenz übergehen, gerade deshalb so umstritten – und führen bei nicht wenigen Beobachtern (unter anderem bei Papst Franziskus) zu Recht zu den Befürchtungen, hier gehe es am Ende doch um den Weg hin zu einer anderen Kirche. Denn tatsächlich haben wir weltweit seit der Reformation Kirchen und kirchliche Gemeinschaften, die ihre Entwicklungen auch unter den Vorzeichen einer anderen Anthropologie (z.B. lutherisch: «natura humana totaliter corrupta») genommen haben, die wesentlich von der sakramentalen (d.h. auch: marianischen) Dimension des Menschen und folglich auch der Kirche absieht. Und es sind eben diese Entwicklungen, die uns heute im ökumenischen Gespräch auf der Suche nach einem gemeinsamen Verständnis von Sakrament und Kirche so herausfordern.
Meines Erachtens ist das kein Zufall, sondern eben innere Logik als Folge des schwächer werdenden Glaubens an die reale, sakramentale und existenziell befreiende (d.h. heiligende) Präsenz Gottes in seiner Kirche. Das würde aber bedeuten: Die Krise des Glaubens in der Kirche in Deutschland würde letztlich durch den Synodalen Weg nicht behoben, sondern eher verschärft. Denn wo der Glaube, die Erkenntnis und die Erfahrung von realer Gegenwart Gottes in seiner Kirche schwinden, schwindet letztlich auch der eigentliche Faktor ihrer Anziehungskraft – und auch ihrer Widerstandskraft gegen Strömungen, die ihr nicht mehr entsprechen. Und zwar beides unabhängig davon, ob Strukturen gelingend erneuert werden oder nicht.
[1] Vgl. Papst Franziskus, Wage zu träumen! Mit Zuversicht aus der Krise, München 2020, 111.
[2] Zumindest im dogmatischen Verständnis und im Blick auf die Siebenzahl.
[3] Der Einführung einer kirchlichen Straf- und Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie einer Disziplinarordnung würde ich zustimmen. Die Entwürfe liegen in Rom zur Begutachtung. Vgl. hier: https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente_Reden_Beitraege/Bericht- Erzbischof-Schick-31.01.2020.pdf (abgerufen 13.6.2022).
[4] Der angesprochene Grundtext findet sich hier: https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Syn-odalerweg/Dokumente_Reden_Beitraege/SV-III_1.2NEU_Synodalforum-I_Grundtext-Be- schluss.pdf (abgerufen 13.6.2022).Wesentliche Einwände hätte ich aber zu Absatz 4 des Grundtextes: Hier scheint mir das Verhältnis von Pluralität und Einheit insgesamt zu holzschnittartig zugunsten einer theologischen Vielfalt dargestellt – und die Rolle des Lehramtes und der lehramtlichen Orientierungstexte mit zu wenig Verbindlichkeit.
[5] https://texte.online-sw.de/erstelesung/synodalforum_ii_-_grundtext_-_erste_le- sung-46135/281/pdf (abgerufen 13.6.2022). Der Antrag, das Forum möge diskutieren, ob es überhaupt Priester brauche, wurde mit 95 zu 94 Stimmen angenommen.
[6] Hier würde sich die Frage stellen, die beim Synodalen Weg wenig thematisiert wurde: Warum Missbrauchsopfer in der Kirche zu einem hohen Prozentsatz männliche Jugendliche sind – in einem genau gegenläufigen Trend zur weltlichen Gesellschaft, wo die größte Zahl der Betroffenen Mädchen sind: Wen zieht ein zölibatärer Lebensstil an und warum?
[7] https://www.synodale-beitraege.de/de/synodalforen/synodalforum-iv/der-mensch-in-seiner- liebesfaehigkeit-und-der-glaube-der-kirche-ein-grundlegender-diskussionsbeitrag-fuer-das- synodalforum-leben-in-gelingenden-beziehungen-liebe-leben-in-sexualitaet-und-partnerschaft (abgerufen 13.6.2022).
[8] Aus dem Entwurf des Grundtextes, der in erster Lesung mit deutlicher Mehrheit bewertet wurde: https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente_Reden_Beitraege/6.1_ SV-II-Synodalforum-IV-Grundtext-Lesung1.pdf (abgerufen 13.6.2022), 9.
[9] Vgl. das so häufige paulinische «in Christus»: Röm 8,1; 1 Kor 15,22, Gal 3,26 und viele mehr.
Stefan Oster, geb. 1965, Dr. theol. habil., ist seit 2014 Bischof von Passau.