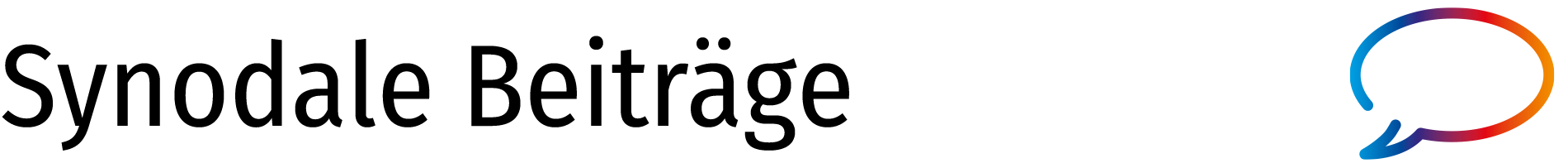17. September 2021 | Mit Petrus Canisius zwischen den Zeiten — Erneuerung aus dem Ursprung als Erinnerung an die Zukunft
Autor: Walter Kardinal Kasper
Quelle: Vortragsmanuskript
Der emeritierte Kurienkardinal Walter Kasper hat sich in einem Vortrag zu grundlegenden Fragen der Krise der Kirche und Wegen der Erneuerung geäußert. Kasper ging dabei explizit auf Reformvorschläge des Synodalen Weges ein. Ausdrücklich stellte er sich hinter den Alternativtext „Vollmacht und Verantwortung“ zu Synodal-Forum I. Der frühere Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen sprach im Rahmen eines Studiennachmittags über Petrus Canisius, den das Akademische Forum der Diözese Augsburg in Kooperation mit dem Verein für Augsburger Bistumsgeschichte veranstaltet hat. Der Vortrag im Wortlaut.
Von Kardinal Walter Kasper, Rom
Die Einladung zu diesem Vortrag war für mich eine willkommene Einladung, mich ausführlich mit Petrus Canisius (1521-1597) zu beschäftigen. Selbstverständlich kannte ich den Kanisi, den Katechismus oder besser: die Katechismen des Petrus Canisius. Doch Begeisterung kam erst auf als ich das spannende Buch von Mathias Moosbrugger las, „Petrus Canisius. Wanderer zwischen den Welten.“[1]
Schnell wurde mir klar, wie aktuell das alles ist. Wanderer zwischen den Welten, das sind auch wir im 21. Jahrhundert. Wir leben nicht nur in einer Zeit rapiden Wandels, vielmehr in einemWandel der Zeit.[2] Wir leben zwischen den Zeiten in einem epochalen Umbruch, der mit dem vor 500 Jahren vergleichbar, von ihm aber auch verschieden ist.
Umbruch bedeutet Zu-Ende-Gehen des Bisherigen und Vertrauten und den Weg in eine noch offene Zukunft. Die Verlusterfahrung erzeugt Trauer und bereitet zugleich Ängste. Sie stellt bange Fragen, wie es weitergehen soll. Als Pfarrer erfahren Sie den Umbruch tagtäglich hautnah, wenn Sie nicht nur eine Gemeinde sondern fünf, sechs und mehr Gemeinden betreuen sollen, wenn die Kirchenbänke am Sonntag leerer werden und wenn sie wahrnehmen, dass Kirche, Priester und Bischöfe einen noch vor zehn oder zwanzig Jahren völlig unvorstellbaren Vertrauens- und Ansehensverlust erfahren haben und uns der Wind nicht nur von außen sondern aus der Mitte der Kirche selbst eiskalt ins Gesicht bläst. Man fragt sich: Kirche, quo vadis?
I. Kirche zwischen Modernismus und Antimodernismus redivivus
Um eine Antwort vorzubereiten, ist es hilfreich, zunächst die gegenwärtige Krise etwas genauer anzusehen. Dazu muss man bis in die Zeit des Petrus Canisius zurückgehen. Damals hat Martin Luther wortgewaltig aber aus innerer Überzeugung eine neue Interpretation des Evangeliums vorgetragen, und den Papst, der ihn exkommunizierte, als Antichrist bezeichnet. Damit brachte er das bislang vertraute Gebäude der Kirche ins Wanken. Die neue reformatorische Gestalt der Kirche breitete sich rasch aus. Als fast alles schon verloren schien, leitete Petrus Canisius in Deutschland eine Erneuerung der Kirche ein, die man lange zu Unrecht als Gegenreformation bezeichnete, und von der die großartige Barockkultur in Bayerisch-Schwaben wie bei uns in Oberschwaben bis heute eindrucksvoll Zeugnis gibt.
Damit stehen wir bereits bei dem grundlegenden Unterschied der Krise damals und heute. Zwischen beiden Krisen stehen die neuzeitliche Aufklärung, die Französische Revolution (1789) und die Revolutionskriege Napoleons, die nicht nur zur Säkularisation der geistlichen Fürstentümer führte, über die wir heute eher froh sind: Es kam auch zu der viel tiefer reichenden Säkularisierung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens.
„Wie soll sich die Kirche in der neuen, sich säkular verstehenden modernen Welt aufstellen? Sie steht vor der Alternative: Widerstand, Anpassung oder Erneuerung von innen aus dem eigenen Ursprung?“
(Walter Kardinal Kasper)
Jetzt ging es nicht mehr um römisch-katholische Kirche versus evangelisch-reformatorische Kirche. Jetzt ging es grundsätzlich zur Sache. Es ging um die Auseinandersetzung mit einer sich autonom und säkular verstehenden Lebenswelt, die ohne Gott auskommen und die Religion auf den privaten Bereich begrenzen wollte.[3] Das ist das Grundproblem auch in der gegenwärtigen Krise. Es geht um die Frage: Wie soll sich die Kirche in der neuen, sich säkular verstehenden modernen Welt aufstellen? Sie steht vor der Alternative: Widerstand, Anpassung oder Erneuerung von innen aus dem eigenen Ursprung?
Schritte auf dem Weg der Erneuerung gab es schon unmittelbar nach der Französischen Revolution. Man denke etwa an den Kreis um den bayerischen Kirchenvater Johann Michael Sailer (1751-1832), an die Katholische Tübinger Schule (Johann Sebastian Drey, Johann Adam Möhler u.a.) und an neue pastorale Ansätze, welche schon damals die deutschen Sprache in der Liturgie und die synodale Verfassung der Kirche anstrebten. Doch die Ansätze wurden durch die einseitig auf innere Geschlossenheit und auf Abgrenzung nach außen bedachte Neuscholastik niedergewalzt.[4] Theologie und Kirche verloren damit den Kontakt zur modernen Lebenswelt, und Theologen, welche den Anschluss an die neue Zeit suchten, wurden als Modernisten verdächtigt. Diese Auseinandersetzung zwischen Modernisten und Antimodernisten führte zu einer der schwersten Krisen der Kirchengeschichte, die bis heute nicht ausgestanden ist.[5]
Mit dem Ersten Weltkrieg (1914-18) war die aufgeklärte bürgerliche Epoche zu Ende. Die Krise der bürgerlichen Kultur mündete in die totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts und in die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs (1939-45). In den Schloten von Auschwitz ist die europäische Kultur in Rauch aufgegangen. In der Kirche kam man zur Besinnung. Besonders in Frankreich und Deutschland kam es zwischen den beiden Weltkriegen zu einer liturgischen, biblischen, patristischen, katechetischen und pastoralen Erneuerung. Man entdeckte die Reichtümer der Tradition neu und entdeckte deren nicht zu unterschätzende Innovationspotenziale, die Brücken schlagen zur modernen Welt. Glaube und Vernunft sind ja keine Gegensätze; im Gegenteil, sie sind gleichsam „die beiden Flügel, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt.“[6]
Johannes XXIII. erkannte die Zeichen der Zeit. Er widersprach allen Unheilspropheten und sah eine neue Morgenröte heraufziehen. Mit der Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils wollte er eine Neubesinnung auf den Glauben, um die Kirche wieder zukunftsfähig zu machen.[7] Das Konzil (1962-65) erstrebte eine solche Erneuerung aus den Ursprung und damit zugleich eine konstruktive Zuwendung zur modernen Welt. Die Antithese zwischen anpasserischem Modernismus und sich einigelndem reinen Antimodernismus sollte überwunden werden. So entwarf das Konzil ein Kirchenverständnis, das trinitarisch und christologisch begründet war und die Kirche als wanderndes Volk Gottes verstand, das offen ist für den Dialog mit den anderen Kirchen, mit dem Judentum und den Religionen, wie mit der modernen Welt. Die Kirche wurde neu verstanden als eine paradoxe, theologisch ausgedrückt eine sakramentale göttlich-menschliche Wirklichkeit, als heilige Kirche und doch Kirche der Sünder zugleich (LG 8).
„So ist der Streit zwischen Modernisten und Antimodernisten in verschärfter und vergifteter Form neu aufgebrochen.“
(Walter Kardinal Kasper)
Damit hat die katholische Kirche einen Erneuerungsprozess hingelegt, wie er im 20. Jahrhundert keiner anderen Kirche gelungen ist. Er zeigte: Die katholische Kirche ist keine starre unbewegliche Größe; sie ist auch nach fast 2000 Jahren jung geblieben. Das hat damals zu einer Aufbruchsstimmung geführt, die mich als junger Priester wie viele andere begeistert und beflügelt hat und die bestimmend geworden ist für mein theologisches Denken und meinen pastoralen und ökumenischen Einsatz. Davon zehren ich und viele meiner Generation bis heute.
Diese Aufbruchsstimmung ist Geschichte. Man kann sie heute jungen Menschen nicht mehr vermitteln. Für alle, die jünger als 60 Jahre alt sind und die das das Konzil nicht mehr bewusst erlebt haben, ist das Konzil ein Geschehen in einer längst vergangenen anderen Zeit. Sie erleben nicht den Aufbruch, sie erleben eine von Krisen geschüttelte Kirche. Der damalige Aufbruch scheint ausgereizt, verbraucht und irgendwie verpufft zu sein. „La Chiesa brucia“- „Die Kirche brennt“ überschrieb Andrea Riccardi, der Gründer von Sant‘Egidio, sein letztes Buch unter Bezugnahme auf den Brand von Notre Dame in Paris, die auch für Nichtgläubige als Symbol französischer und europäischer Geschichte und Kultur gilt.[8] Ist mit der Kirche vielleicht auch Europa am Ende?
Wie konnte es dazu kommen? Wie meist gibt es viele Ursachen. Ganz Europa und der ganze Westen stehen in einer Orientierungskrise; die Kirche lebt nicht neben sondern mitten in dieser krisengeschüttelten Welt; sie nimmt an der allgemeinen Krise teil. Dazu kommen Ursachen innerkirchlicher Art. Das Konzil konnte nicht alles zu Ende führen, hat manches offen gelassen oder, um zu einem Konsens zu kommen, manches kompromisshaft formuliert. Das führte nach dem Konzil zum erbitterten Streit um die rechte Konzilsauslegung.[9] Das römische Lehramt suchte zu Recht, das Konzil in die Kontinuität der Tradition einzuordnen, doch die weiter- und zukunftsweisenden Aspekte traten dabei in den Hintergrund. Dieser Aufbruch, den das Konzil wollte, schien ausgebremst. Die Tradition, die es erneuern wollte erschien mehr als Bollwerk denn als Erinnerung an die Zukunft.[10] Enttäuschung und Unmut machten sich breit.
Mitten in die bereits angespannte Situation platzte der Missbrauchsskandal. Er hat innerkirchliche Probleme und Schwachstellen offen gelegt. Verdrängen oder schönreden hilft nicht. Die Diskussion einfach verbieten, geht heute gleich gar nicht. Es führt kein Weg daran vorbei, die Probleme müssen angepackt werden. Probleme, die man verdrängt, rumoren im Unterbewusstsein weiter und machen krank.
So ist der Streit zwischen Modernisten und Antimodernisten in verschärfter und vergifteter Form neu aufgebrochen. Die einen wollen eine Kirche, welche den Standards der Moderne entspricht: Sie wollen Demokratisierung und mehr Mitspracherechte in der Kirche, kämpfen für die Rechte und Gleichstellung der Frauen, auch für die Ordination von Frauen, für Selbstbestimmung besonders im Bereich der Sexualität, Abschaffung des Zölibats u.a. Andere verharren auf dem Status quo oder wollen gar zurück in einen Status quo ante vor das II. Vatikanum wie die von Erzbischof Marcel Lefebvre gegründete Pius- bruderschaft, die neuerdings Unterstützer auch aus der katholischen Kirche findet.
Öffentlich tonangebend sind die Extreme, was fehlt ist die Stimme einer breiten Mitte, welche die geistige und die geistliche Kraft hat, die berechtigten Anliegen beider Seiten zu vermitteln und die Extreme an die Ränder zu drängen. Es gibt diese Mitte. Sie ist da im Lebenszeugnis und Engagement vieler Christen, welche als Beter die atmende Lunge der Kirche sind. Sie ist da in den unzähligen verfolgten Christen und in den Millionen Christen, die zu den Armen und Ärmsten dieser Welt gehören. Sie haben andere Probleme als wir aufgeklärte Europäer. Doch ihre Stimme dringt bei uns kaum durch. Ihr gilt es mehr Gehör zu geben.
„Am Ende fragen sich viele, ob das alles noch ganz katholisch ist. Manche Aussagen weichen deutlich von Grundanliegen des II. Vatikanums ab, etwa beim sakramentalen Verständnis der Kirche und des Bischofsamtes wie der Zusammengehörigkeit von ordo und iurisdictio.“
(Walter Kardinal Kasper)
Wie kann das geschehen? Zwei Vorlagen beim Synodalen Weg zeigen die Alternative. Die eine, „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche“, versucht angesichts der Krise die Kirche mit Hilfe eines gelehrten theologischen Theoriegebäudes gewissermaßen neu zu erfinden. Darin steht viel Richtiges, aber auch viel Hypothetisches. Am Ende fragen sich viele, ob das alles noch ganz katholisch ist. Manche Aussagen weichen deutlich von Grundanliegen des II. Vatikanums ab, etwa beim sakramentalen Verständnis der Kirche und des Bischofsamtes wie der Zusammengehörigkeit von ordo und iurisdictio.
Der Gegenvorschlag „Vollmacht und Verantwortung“ setzt anders an. Er stellt sich klar auf den Boden des Konzils, der uns allen gemeinsam sein sollte. Er anerkennt die offenen Fragen, die das Konzil hinterlassen hat und sucht auf dem sicheren Boden des Konzils den Weg des Konzils weiterzugehen. Dabei kann er zeigen: Man muss gar nicht alles auf den Kopf stellen. Auf dem Boden des Konzils kann man im Geist des Konzils über das Konzil hinausgehen ohne mit der Kirchenlehre in Konflikt zu geraten. Das ist der Weg der lebendigen Tradition, der Weg der Kirche. Er versteht die Tradition nicht als abschreckendes Bollwerk, sondern als Einladung, sich auf den Weg der Kirche zu machen und sich dabei auch von neuen Einsichten überraschen zu lassen.
Ich kann nur hoffen, dass beide Seiten die Größe haben, aufeinander zuzugehen. Denn wenn wir wirklich einen Aufbruch wollen, brauchen wir nach synodaler Tradition am Ende eine einmütige Antwort, die nicht spaltet, sondern zusammenführt. Ausgehend von einer nicht toten, sondern lebendigen Tradition möchte ich darum im Folgenden die gegenwärtige Krise als Herausforderung zu einem gemeinsamen Aufbruch in gemeinsamer Weggemeinschaft verstehen.
II. Die Krise als geistliche Herausforderung
Das griechischen Wort Krise bedeutet nicht Zusammenbruch; eine Krise ist eine sich zuspitzende Situation, in der sich alles zum Guten oder zum Schlechten wenden kann. Eine Krise ist eine Herausforderung, bei der es darauf ankommt, was man aus ihr macht. Sie ist kein Schicksal; sie ist uns zur aktiven Gestaltung aufgegeben.[11]
So hat Petrus Canisius seine Situation verstanden. Er wollte Kartäuser werden und ein klösterlich zurückgezogenes Leben führen, bis er Peter Faber aus dem ursprünglichen Kreis um Ignatius von Loyola begegnete. Bei ihm lernte er eine andere Spiritualität kennen, die sich nicht aus der Welt zurückzieht, die vielmehr missionarisch in die Welt hinausgeht, eine Spiritualität, die Aktion und Kontemplation miteinander verbindet. Die ignatianische Spiritualität kann man in dem Satz zusammenfassen: In actione contemplativus, in contemplatione activus (J. Nadal).[12] Sie ist Aktivität, die aus der Kontemplation erwächst und Kontemplation, welche in der Aktivität fruchtbar wird.
Erfüllt vom Feuer dieser Spiritualität hat Petrus Canisius es geschafft, in einer Situation, in der Augsburg, große Teile Österreichs und Süddeutschlands und selbst Köln auf der Kippe standen, das Rad der Geschichte nochmals herumzureißen. So kann Petrus Canisius uns sagen: Nicht Gejammer oder resignative Ergebenheit in ein vermeintliches Schicksal, nicht Polemik und gegenseitige Zerfleischung helfen weiter. Der Ausweg ist auch nicht eine Frage der Zahlen. Auch Einzelne können eine Krise zum Besseren wenden, wenn sie von Glaube, Hoffnung und Liebe erfüllt im Einsatz für die Sache Gottes und seines Reiches sich in die Schanze schlagen.
„Die ganze Kirchengeschichte ist eine Reformgeschichte. Aber strukturelle Reformen allein nützen wenig. Die gegenwärtige Krise ist zu tief, als dass wir sie aus eigener Kraft stemmen könnten.“
(Walter Kardinal Kasper)
Selbstverständlich sind Reformen nötig. Die Kirche bedarf immer der Reform und der Erneuerung (LG 8; UR 4; 6). Die ganze Kirchengeschichte ist eine Reformgeschichte. Aber strukturelle Reformen allein nützen wenig. Die gegenwärtige Krise ist zu tief, als dass wir sie aus eigener Kraft stemmen könnten. Auch die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie nicht aus sich selbst hat (W. Böckenförde). Das gilt noch mehr von der Kirche. Sie ist die Gemeinschaft des Glaubenden. Den Glauben kann man nicht machen und nicht organisieren. Er ist ein Geschenk der Gnade. „Ohne mich könnt ihr nichts tun“ (Joh 15,5). Allein in Christus, der in der Auferstehung die bösen Mächte besiegt hat, können Christen in jeder Situation Menschen der Hoffnung sein, die alles auf eine Karte setzen und dem Evangelium zutrauen, dass es Heil und Rettung ist.
Wenn ich nun höre: Wir können das Evangelium erst wieder verkünden, wenn wir uns durch Reformen glaubwürdig gemacht haben, so ist das Häresie pur, Häresie eines ekklesiologischen Pelagianismus‘, einer Werksgerechtigkeit, die meint Kirche „machen“ zu können. Nein, darin hatte Luther recht: Die Kirche ist creatura verbi. Die Kirche entsteht aus der Verkündigung des Evangeliums. Nicht wir sündige Menschen machen das Evangelium glaubwürdig; das Evangelium ist als Gottes Wort Gottes Kraft (Röm 1,16), es rechtfertigt uns und es hat die Kraft, zu „überzeugen.“
Wir brauchen nicht Macher, wir brauchen auch nicht immer neue Papiere. Wir sind in der Kirche ja geradezu eine Papierfabrik geworden. Wir brauchen Zeugen des Evangeliums, denen man abnimmt, dass sie glauben, was sie sagen und die das, was sie glauben, mit Gottes Gnade auch leben. Es waren die Heiligen, welche die Kirche nach der Krise der Reformation wieder in Schwung brachten: Vor Petrus Canisius Ignatius von Loyola, dann Karl Borromäus, Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz, Franz von Sales u.a. Wir brauchen einen neuen Petrus Canisius als dritten Apostel Deutschlands. Fragen wir darum ihn, was er uns heute raten würde.
III. Das Evangelium Quelle der Erneuerung
Ich beschränke mich auf drei Fragen: Was sollen wir tun? Wie sollen wir es tun? Und wer soll es tun? Zur ersten Frage: Wir brauchen einen klaren Kompass. Ein Kompass ist kein Baedeker, der alle künftigen Wegstation im Voraus beschreibt. Ein Kompass gibt nur die Richtung an, und die Richtung muss stimmen. In der Krise des 16. Jahrhunderts hat das Trienter Konzil die Richtung klar definiert. Gleich auf der ersten Sitzung, die sich mit den dogmatischen Fragen befasst hat: „Das Evangelium ist Quelle aller Heilswahrheit und Disziplin“ (DH 1501). Das Evangelium ist kein Buch und kein Kodex von Glaubenssätzen und moralischen Normen, vielmehr eine lebendige, eine frisch sprudelnde Quelle, nicht laues, altes, abgestandenes, vielmehr sprudelndes frisches Wasser – frisches Wasser, ohne das kein Leben möglich ist.
Wahrscheinlich hätte es Petrus Canisius nicht ganz so ausgedrückt. Aber der Sache nach geht es in den Exerzitien des Ignatius von Loyola um nichts anderes als um die Einübung in die Nachfolge Jesu und die radikale Lebensentscheidung, für die größere Ehre und das Reich Gottes einzutreten.
Seit dem Konzil sind „Evangelium“ und „Evangelisieren“ Grundworte des Glaubens und des kirchlichen Lebens geworden. Papst Paul VI. hat in Evangelii nuntiandi (1975) das Grundanliegen des II. Vatikanums zusammengefasst: „Evangelisieren ist in der Tat die Gnade und eigentliche Berufung der Kirche, ihre tiefste Identität. Sie ist da, um zu evangelisieren“ (Nr.14) Damit war die Grundmelodie der Nachkonzilszeit angestimmt, in die alle folgenden Päpste eingestimmt haben. Papst Franziskus hat in seiner Programmschrift Evangelii gaudium (2013) diesen Cantus firmus aufgenommen und ihn in seinem Brief an das pilgernde Gottesvolk in Deutschland der deutsche Kirche ans Herz gelegt.
„Es war wirklich ein starkes Stück, dass man in Deutschland den Brief des Papstes, beiseitegelegt und einen eigenen Weg eingeschlagen hat.“
(Walter Kardinal Kasper)
Es war wirklich ein starkes Stück, dass man in Deutschland den Brief des Papstes, beiseitegelegt und einen eigenen Weg eingeschlagen hat. Was gibt es denn Besseres als das Evangelium? Im Alten Testament ist es die Botschaft von der Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft (Jes 52,7; 62,1), bei Jesus die Botschaft vom Kommen des Reiches Gottes, die Botschaft von der heilenden Nähe und der Menschenfreundlichkeit Gottes (Mk 1,14 f; Lk 4,18 f), bei Paulus die Botschaft von Tod und Auferweckung Christi als Sieg über den Tod und die bösen Mächte in der Welt (1 Kor 15,3-5), also eine Botschaft der christlichen Freiheit, der Hoffnung und der Freude. Es ist die Frohe Botschaft von der Revolution der Zärtlichkeit und der Liebe![13]
Als die Jünger beim Abschied Jesu Sorge hatten, wie es weitergehen solle, hat Jesus keine Ämter eingesetzt und gemeint, damit sei für die Kirche bis zum Weltende mehr als genug gesorgt; er hat seinen Jüngern auch kein Buch übergeben, das sie lesen sollen, um aus ihm alles Weitere zu entnehmen. Er hat den anderen Parakleten den Hl. Geist versprochen, der sie an all das erinnern und in alle Wahrheit einführen soll (Joh 14,16. 26; 15,26; 16,13 f). Das Evangelium ist die im Hl. Geist bleibende Gegenwart des Wortes Gottes in den Herzen der Gläubigen. Das Konzil sagt darum: Im Hl. Geist geht der Dialog Gottes mit der Kirche weiter, damit das Evangelium in der Kirche und durch die Kirche in aller Welt erschallen kann (DV 8). Darum mahnt das letzte Buch der Bibel mehrfach zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt (Offb 2,7 u.a.).[14]
Es geht im Evangelium nicht primär um die Kirche, ihre Ämter und Strukturen. Sie sind nicht das Heil, sie sind nur Heilsmittel. Es geht um die Frohe Botschaft von Gott, von Jesus Christus, seinem Tod und seiner Auferstehung, vom Wirken des Hl. Geistes und der Hoffnung auf das ewige Leben. Das sind keine rein theoretischen Fragen. Sie sind Ruf zur Umkehr, zu einer grundsätzlichen Kehrtwende und Kurskorrektur und zu einem neuen Denken (metanoia) (Mk 1,15; Röm 12, 2). Es geht um das Hauptgebot der Liebe (Mth 22,37-40 par.), das in der Bergpredigt konkret wird als Zuwendung zu den Armen, Kleinen, den Trauernden und den Verfolgten (Mth 5,3-11; Lk 6,20-26). In ihnen begegnen wir Jesus Christus heute (Mth 25). Sie sind Zeichen der Zeit und legen uns das Evangelium konkret aus. Mit dieser Botschaft können wir Salz der Erde und Licht der Welt sein (Mth 5,13-16).
„Wir müssen uns auf die Hierarchie der Wahrheiten besinnen, uns auf das Wesentliche konzentrieren statt uns in rein innerkirchlichen Problemen zu verkrallen und unsere Zeit in Lagerkriegen zu vergeuden.“
(Walter Kardinal Kasper)
Wir müssen uns auf die Hierarchie der Wahrheiten besinnen (UR 11), uns auf das Wesentliche konzentrieren statt uns in rein innerkirchlichen Problemen zu verkrallen und unsere Zeit in Lagerkriegen zu vergeuden. Das sind nicht die Probleme der Menschen. Die Menschen brauchen und erwarten etwas anderes. Sie brauchen Trost, Orientierung, Glaube, Hoffnung und Liebe, Freude. „Spalancate le porte“, „Habt keine Angst! Öffnet, ja reißt die Tore auf für Christus!“ hat uns Johannes Paul II. am 22. Oktober 1978 bei seiner Antrittspredigt auf dem Petersplatz zugerufen. Darum ging es Petrus Canisius und darum geht es auch heute.
IV. Evangelium für eine künftige Generation
Nun zum zweiten Punkt. Wie hat Petrus Canisius das gemacht? Die frühen Jesuiten folgten keinem vorgefassten Plan. Sie waren anders als wir Deutschen, die, bevor wir anfangen, endlose Positionspapiere verfassen, um im Voraus alles bis ins Einzelne zu regeln. Anders die frühen Jesuiten. Sie engagierten sich auf verschiedensten Missionsfeldern, bis eines Tages die Stadtväter von Messina auf Sizilien auf sie zukamen und sie baten, ihre städtische Schule zu übernehmen. Das war für sie etwas Neues, darauf waren sie in keiner Weise vorbereitet. Doch als Ignatius sich dafür entschieden hatte, war die Sache für Petrus Canisius klar. Er machte den Job und hatte Erfolg. Bald war Bayern mit Studienhäusern der Jesuiten geradezu übersät: Kaufbeuren, Mindelheim, Landshut, Ingolstadt, Eichstätt, Regensburg, München, Straubing, Passau u.a.
Canisius war der Überzeugung: Wer in der Welt wirken will, der muss die Welt kennen und sie verstehen. Darum wollte er begabte junge Menschen heranbilden, ihnen im Licht des Glaubens das Wissen seiner Zeit vermitteln. Damit lag er ganz in der kirchlichen Tradition. Die mittelalterlichen Mönche waren mit ihren Klosterschulen Transmissionsriemen, welche die antike humanistische Bildung dem Mittelalter übermittelten und damit die Grundlage für die Kultur Europas schufen.
In unseren beiden Diözesen Augsburg und Rottenburg-Stuttgart haben wir Schulen in kirchlicher Trägerschaft, die nach dem Marchtaler Plan arbeiten. Ihnen geht es nicht nur um Ausbildung, sondern um gesamtmenschliche Bildung, um Wissen, das mit sittlich-religiöser Gesamtbildung und mit sozialer Praxis verbunden ist. Damit können wir dem heute weit verbreiteten Narrativ einer rein säkularistischen, weithin ökonomischen und naturwissenschaftlichen Weltsicht eine ganzheitliche christliche und katholische Vision entgegenstellen. Letztlich ist Bildung ein theologischer Begriff, dem es darum geht, das Bild Gottes, nach dem wir geschaffen sind, auszubilden.
„Wenn wir weiterhin gesellschaftlich etwas zu sagen haben wollen, dann brauchen wir eine neue Generation von jungen Männern und Frauen, eine nicht nur gut ausgebildete, sondern eine umfassend gebildete katholische Elite, die nicht sozial abgehoben, sondern sozial engagiert ist.“
(Walter Kardinal Kasper)
Wenn wir weiterhin gesellschaftlich etwas zu sagen haben wollen, dann brauchen wir eine neue Generation von jungen Männern und Frauen, eine nicht nur gut ausgebildete sondern eine umfassend gebildete katholische Elite, die nicht sozial abgehoben sondern sozial engagiert ist. Ohne eine solche Leadership wird der Glaube zur Außenseiterposition. Er ist dann nicht mehr Sauerteig und Seele, die das Ganze durchdringt. Wir sind dann nicht mehr katholisch; wir werden zur Sekte. Das ist ein langfristiges Programm, das nicht schon morgen und übermorgen Erfolg bringt; aber eben deshalb ist es auch nachhaltiger als alle spektakulären Events. Sie sind meist ein Feuerwerk, das schnell niederbrennt und wieder verlöscht.
Innerhalb einer solchen Bildung einer neuen Generation hat die katechetische Bildung ihren Platz. Man muss den Glauben kennen, den man bekennen soll. Katechese reicht darum bis in die früheste Kirche zurück. Im 16. Jahrhundert hat keiner die Bedeutung der Katechese besser begriffen als Martin Luther; mit seinen zwei Katechismen hat er entscheidend zur Festigung und Weitergabe des reformatorischen Glaubens beigetragen. In diesem Punkt hat Canisius von ihm gelernt und er hatte damit einen Bombenerfolg. Es gelang ihm in den katholisch gebliebenen Teilen Deutschlands, den katholischen Glauben nachhaltig zu festigen. Bei meiner ersten Afrikareise habe ich von den Weißen Vätern gelernt, dass Katechese das Erfolgsrezept der Mission ist.
Der „Katechismus der katholischen Kirche“ (1992) ist für die meisten eine schwierige Kost. Doch als daraus der Youcat (2011) wurde, hat er in kurzer Zeit mit vielen Auflagen und Übersetzungen gezeigt, dass man auch heute die Glaubenslehre in einer ansprechenden Sprache überzeugend sagen kann. Ich habe Ähnliches erlebt. Als ich am Deutschen Erwachsenenkatechismus (1985) mitgewirkt hatte, hat ein Hildesheimer Priester (Winfried Henze) den Katechismus in flotte Briefform übertragen (Briefe an Kerstin „Glaube ist schön“) und flugs 11 Auflagen erzielt. Sage niemand, der Glauben lasse sich heute nicht mehr vermitteln. Im Gegenteil, viele suchen nach solider Glaubensinformation, und sie wollen dann auch wissen, was Sache ist.
„Allzu viele Christen sind sprachlos geworden; sie wissen nichts zu antworten und schweigen, oder sie fallen auf jeden Nonsens herein. Wir brauchen Katechese als Sprachschule des Glaubens.“
(Walter Kardinal Kasper)
Natürlich ist der Glaube keine Sammlung von Katechismus-Sätzen, die man wie am Schnürchen aufzählen kann; er ist auch kein bloßes Gefühl. Gott hat sich konkret in Jesus Christus als Weg, Wahrheit und Leben geoffenbart (Joh 14,6). So hat der Glaube einen konkreten Inhalt, den man kennen muss, um ihn bekennen zu können. „Gebt jedermann Rechenschaft von eurer Hoffnung“ (1 Petr 3,15). Dazu muss er sprachfähig, auskunftsfähig, antwort- und rechenschaftsfähig sein. Allzu viele Christen sind sprachlos geworden; sie wissen nichts zu antworten und schweigen, oder sie fallen auf jeden Nonsens herein. Wir brauchen Katechese als Sprachschule des Glaubens.
Der schulische Religionsunterricht ist wichtig, aber er kann unter heutigen Voraussetzungen nicht mehr Katechese sein. Das ging gut so lange als Kirche und Schule nicht nur räumlich nahe beieinander waren und die Schule wie die gesamte Gesellschaft von einer gewissen christlichen Grundmentalität und die Schüler aus praktizierenden Familien kamen. Doch Schülern von Sakramenten erzählen, die kaum einmal eine Kirche von innen gesehen und kaum einmal an einem Gottesdienst teilgenommen haben, ist ungefähr wie Schwimmübungen im Trockenen. Katechese ist nur in einem kirchlichen Zusammenhang möglich, in dem Glaube und Leben konkret erfahrbar sind.
Doch ein paar Wochen Erstkommunionkatechese, die Firmkatechese noch wesentlich kürzer, die Ehevorbereitung oft an zwei Abenden, von Taufvorbereitung, das Kernstück der Katechese, gar nicht zu reden, genügt nicht. In den USA und jetzt in Rom habe ich erfahren, dass es auch ganz anders geht... Ich will nicht ungerecht sein. Es gibt auch bei uns Ansätze: Familienkatechse, Ehekatechese; Feriencamps, Jüngerschaft-Schule, Kompaktseminare u.a. Doch insgesamt sind wir katechetisches Notstandsgebiet. So werden wir keine Zukunft haben. Wir versäumen es, eine neue Generation für das 21. Jahrhundert vorzubereiten. Wir haben von Petrus Canisius noch viel zu lernen.
V. Eine synodale Gestalt der Kirche
Nun zum dritten Punkt. Nach der Frage: „Was sollen wir machen, und wie sollen wir es machen?“ Nun die Frage: „Wer soll das machen?“ Ich fürchte, mit diesem Punkt komme ich mit Petrus Canisius in Konflikt. Er hat die Trienter Kirchenreform in klarer Abgrenzung von der Reformation umgesetzt. Weil die Protestanten das allgemeine Priestertum gelehrt und das hierarchische Kirchenverständnis abgelehnt haben, hat die katholische Reform nun erst recht die hierarchische Struktur der Kirche betont.
Das II. Vatikanischen Konzil hat auch von der hierarchischen Struktur gesprochen, aber es innerhalb des Verständnisses der Kirche als Volk und der Teilnahme aller Getauften am gemeinsamen Priestertum (LG 10); es hat vom Glaubenssinn des ganzen Gottesvolkes (LG 12) und von der Mitverantwortung aller in der Kirche gesprochen (LG 30-38). Das vertikale Kirchenverständnis von oben nach unten ist damit durch das Bild einer partizipativen und kommunikativen Kirche ersetzt und eine Wende von einer Betreuungskirche zu einer Beteiligungskirche eingeleitet.
Papst Franziskus hat aus diese kopernikanischen Wende die Folgerung gezogen und seine Vision für die Kirche im dritten Jahrtausend formuliert. „Die Welt, in der wir leben,... verlangt von der Kirche eine Steigerung ihres Zusammenwirkens in allen Bereichen ihrer Sendung. Genau dieser Weg der Synodalität ist das, was Gott sich von der Kirche des dritten Jahrtausends erwartet.“[15] Inzwischen hat er zum Thema der Synodalität eine eigene Bischofssynode einberufen und dazu eine weltweite Befragung der Gläubigen eingeleitet.[16] Also eine große Mitmach-Aktion!
Das scheint manchen ein revolutionäres Programm zu sein; doch es ist das konservativste Reformprojekt, das man sich denken kann. Es will unter heutigen Voraussetzungen den Schwung erneuern, der die apostolische Kirche im sogenannten Jerusalemer Apostelkonzil befähigt hat, den Übergang von der Judenkirche zur Heidenkirche zu wagen (Apg 15). Synoden waren dann die Art und Weise, wie die Kirche im ersten Jahrtausend und noch bis ins Hochmittelalter gelebt hat. Schon Trient wollte die synodale Praxis erneuern.[17] Karl Borromäus, das Modell des nachtridentinischen Reformbischofs, hat auf dem Weg von Synoden die Trienter Reform in Mailand durchgeführt und dies mit Erfolg. Das II. Vatikanum hat darum gewünscht, „dass die ehrwürdigen Einrichtungen der Synoden und Konzilien mit neuer Kraft aufblühen“ (CD 36).
„Nicht einer kann alles, aber auch nicht jeder kann alles. Jeder hat von Gott sein Charisma erhalten und soll das des anderen achten.“
(Walter Kardinal Kasper)
Die Kirche des 21. Jahrhundert soll also synodal aufblühen. Sie ist keine absolute Monarchie, keine Aristokratie, oder eine Bürokratie, in der alles von oben nach unten entschieden wird; sie wird auch keine parlamentarische Demokratie sein, so sehr sie im Stil und in Verfahrensformen von der Demokratie lernen kann. Sie hat ihre eigene institutionelle Gestalt. „Synode ist der Name der Kirche“ (Johannes Chrysostomos).[18] Synode heißt Weggemeinschaft und Zusammenspiel aller Charismen und Ämter in der Kirche. Die Goldene Regel dieses Zusammenspiels lautet daher: Die Synode kann nichts ohne oder gar gegen den Bischof tun, der Bischof aber soll in wichtigen Fragen nichts ohne die Synode tun.[19] Nicht einer kann alles, aber auch nicht jeder kann alles. Jeder hat von Gott sein Charisma erhalten und soll das des anderen achten.
Das gilt besonders für das Amt des Bischofs. Der Bischof ist nicht eine Art auf Zeit gewählter Vorsitzender eines Aufsichtsrats, den man absetzt, wenn er nicht bringt, was man von ihm erwartet. Sein Amt wird ihm durch sakramentale Weihe und nicht durch Beauftragungen durch die Synode übertragen (LG 19 f). Man kann ihn, wenn nicht schwerwiegende Vergehen vorliegen, nicht einfach vom Hof jagen. Umgekehrt soll der Bischof auch auf die Gläubigen hören. Wenn es um das Festhalten am Evangelium geht, soll consensio, Einklang herrschen zwischen Vorstehern und Gläubigen (DV 10). So ist die Synode ein konsensorientierter Austausch. Sie ist Ausdruck gewaltfreier Beziehungen, in denen es nicht darum geht, vorgefasste Ideen oder Interessen durchzusetzen und andere niederzustimmen. Biblisch ist der Rat eine Gabe des Hl. Geistes (Jes 11,7). Die Beratung soll ein kleines Pfingsten sein, das den Streit beendet, Friede stiftet und erneut Mission ermöglicht.[20]
Als synodales Zusammenspiel aller Charismen mit dem Bischof und des Bischofs mit ihnen sind die Synoden eine charismatische Unterbrechung der alltäglichen Routine, um gemeinsam auf Gottes Wort zu hören und aufeinander zu hören, was Gott uns im Hl. Geist sagen will. Das kann eine Chance zur Wegkorrektur hinaus aus institutionellen Verfestigungen sein, ein Beitrag zur Neuerweckung des Geistes des Evangeliums wie eine Besinnung auf den künftigen Weg.
Da ist schon heute viel mehr möglich, als viele meinen. Jeder Bischof kann schon heute, ohne auch nur ein Häkchen am Dogma zu ändern, synodale Strukturen schaffen und dabei auch Formen der Mitwirkung bei Pfarr- und Bischofsbesetzungen vorsehen. Manche Diözesen tun das bereits seit Jahrzehnten. Niemand kann verbieten darüber hinausgehende Wünsche, sogenannte Voten an den universalen Gesetzgeber zu richten. Kurzum, der Weg zu mehr Mitbestimmung ist auf der Grundlage des Konzils und mit dem Konzil über das Konzil hinaus offen. Man muss nicht alles umkrempeln; man muss nur den Weg der Kirche und des Konzils mutig weitergehen. Dann brauchen wir keine Angst haben; dann haben wir die Verheißung des Herrn auf unserer Seite.
„Man kann und man muss die Kirche erneuern, aber neu erfinden kann man sie nicht. Das Evangelium Christi ist die Quelle, die ewig jung ist. Aus ihr wird sich die Kirche – da bin ich mir sicher – erneuern und verjüngen.“
(Walter Kardinal Kasper)
Damit komme ich zum Schluss. Wir sind ausgegangen von dem Umbruch angesichts des Zu-Ende-Gehens der Volkskirche bisherigen Stils. Wir haben über das Evangelium als Kompass für den weiteren Weg gesprochen, dann über das Wie der Heranbildung einer neuen Generation, und schließlich über die Akteure eines Neuaufbruchs, zu dem alle Getauften und alle guten Willens eingeladen sind.
Ein ausgefeiltes Zukunftsprojekt hat niemand. Das Evangelium ist kein Flutlicht, das die Rollbahn bis auf die letzte Ecke ausleuchtet, und noch weniger eine Blendlaterne. Es ist wie ein Lämpchen, das in der Dunkelheit nach jedem Schritt Licht gibt für den jeweils nächsten Schritt. Das geht langsam, aber sicher. Es ist wie beim Bergsteigen: Man macht Schritt für Schritt, Griff nach Griff, Sprünge wären ein Salto mortale, wichtig dagegen die verlässliche Seilgemeinschaft. Darum keine Sondertouren. Nur gemeinsam können wir den Gipfel erreichen.
Die gegenwärtige Krise ist nicht die erste Krise; sie wird auch nicht die letzte sein. Nach den Abschiedsreden Jesu im vierten Evangelium wird die Kirche immer in Bedrängnis sein, immer steht sie zugleich unter der Verheißung des Herrn. Das Motto des Petrus Canisius war: Perseverare, durchhalten, dran bleiben, nicht aufgeben, und das im Wissen: Christus vivit. Es gibt keinen anderen Weg als der, den das Evangelium weist. Einen anderen Grund kann niemand legen (1 Kor 3,11). Man kann und man muss die Kirche erneuern, aber neu erfinden kann man sie nicht. Das Evangelium Christi ist die Quelle, die ewig jung ist. Aus ihr wird sich die Kirche – da bin ich mir sicher – erneuern und verjüngen. Die Freude des Evangeliums wird auch heute und wird auch in Zukunft überzeugen. Darum nicht griesgrämig und nicht verzagt. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke (Neh 8,10).
Fußnoten:
[1] M. Moosbrugger, Petrus Canisius. Wanderer zwischen den Welten, Innsbruck 2021. Zum 400. Todestag: Petrus Canisius. Reformer der Kirche, hrsg, J. Oswald und P. Rummel, Augsburg 1996.
[2] So Papst Franziskus im „Brief an das wandernde Gottesvolk in Deutschland“ (2019).
[3] C. Taylor, A Secular Age (2007); dt.: Das säkulare Zeitalter, Frankfurt a.M. 2009.
[4] P. Walter, Neuscholastik, in: LThK 7 (1998) 779-782.
[5] O. Weiss, Modernismus, in: LThK 7(1998) 367-37; H. Wolf, Antimodernismus und Modernismus in der katholischen Kirche. Beiträge zum theologiegeschichtlichen Vorfeld des II. Vatikanums. Paderborn 1998.
[6] Johannes Paul II, Enzyklika Fides et Ratio über das Verhältnis von Glaube und Vernunft (1998); Papst Franziskus, Vorwort zu Veritatis gaudium (2017).
[7] So die Rede von Papst Johannes XXIII. zur Eröffnung des Konzils am 11. Oktober 1962.
[8] A. Riccardi, La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo, Bari-Roma 2021. Klare und kritische Aussagen zuSituation der Kirche in Deutschland, S. 55-60.
[9] Dazu Benedikt XVI. beim Weihnachtsempfang der römischen Kurie am 22. Dezember 2005; Literatur bei H.J. Sieben, Kleines Lexikon der Konzilsidee, Paderborn, 2018, 218 Nr. 36.
[10] J. H. Tück (Hrsg,), Erinnerung an die Zukunft. Das Zweite Vatikanische Konzil, 2. Aufl. Freiburg i. Br, 2013; A. U. Müller Hrsg.), Aggiornamento in Münster. Das II. Vatikanum: Rückblicke nach vorn, Münster 2014; C. Böttingheimer u.a. (Hrsg.), Vaticanum 21. Die bleibenden Aufgaben des Zweiten Vatikanischen Konzils im 21. Jahrhundert. Freiburg i. Br. 2016.
[11] So Papst Franziskus in seiner Ansprache beim traditionellen Weihnachtsempfang für die römische Kurie am 21. Dezember 2020.
[12] Die Einheit von Kontemplation und Aktion findet sich schon in dem benediktinischen Grundsatz ora et labora, dann bei Meister Eckehart und in der dominikanischen Laienspiritualität, bei Franz von Sales, heute bei Roger Schütz als „Kampf und Kontemplation.“
[13] W. Kasper, Papst Franziskus – Revolution der Zärtlichkeit und der Liebe. Theologische Wurzeln und pastorale Perspektiven, Stuttgart 2015.
[14] Das ist gemeint, wenn wir theologisch von Tradition sprechen. Gemeint sind nicht einzelne Traditionen und Bräuche; Tradition im theologischen Sinn ist die Selbstüberlieferung des erhöhten Herrn im Hl. Geist zu beständiger Gegenwart in der Kirche und durch die Kirche in der Welt. Vgl. Y. Congar, La Tradition et les traditions (1960-63); dt.: Die Tradition und die Traditionen, Mainz 1965.
[15] So bei der Feier des 50jährigen Jubiläums der Bischofssynode am 17. Oktober 2015.
[16] Dazu das Vorbereitungsdokument: „Für eine synodale Kirche. Gemeinschaft, Partizipation und Mission“ (7. September 2021). Die Literaturliste zum Thema Synode und Synodalität ist bereits lang. Wichtig ist vor allem das Dokument der Internationalen Theologenkommission: Die Synodalität in Leben und Sendung der Kirche (2018).
[17] Decretum de reformatione sessio XXIV, can. 2 (COD 737)
[18] Chrysostomus, Exp. in Psalm. 149: PG 55,493.
[19] So in den Apostolischen Konstitutionen (Sources chrét. 336) Paris 1987, 284. Dieser Kanon ist wurde im Dialog zwischen der katholischen und den orthodoxen Kirchen maßgebend für das im Ravenna-Dokument (2007) und das Dokument von Chieti (2016). Das katholische und orthodoxe Synodenverständnis unterscheidet sich damit vom evangelischen Verständnis der Synode als eine Art Kirchenparlament und Teil der Kirchenregierung. Vgl. Art. Synode, in: TRE 32 (2001) 571-584 und, in: RGG 7 (2004) 1970-77.
[20] Neben dem Kernbereich kirchlichen Auftrags, die Bezeugung des Evangeliums und die Spendung der Sakramente gibt es Bereiche (Finanzen, Bauwesen, Caritas und Soziales u.a.), in denen m.E. Mehrheitsabstimmungen möglich sind. Es würde genügen, dem Bischof ein Vetorecht einzuräumen, um eklatante Fehlentscheidungen zu verhindern.